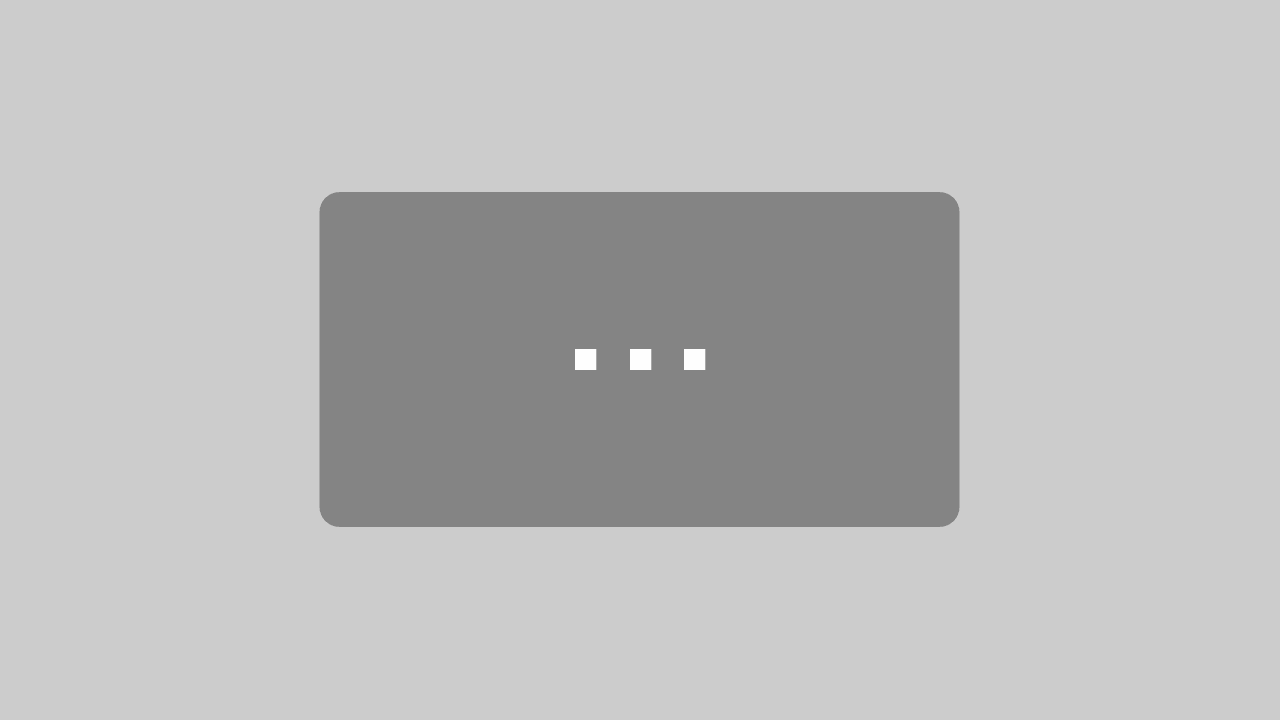Der Bodenständige
Cornel Lascu führt einen kleinen Bauernhof in Siebenbürgen. Wie viele andere rumänische Bauern versucht er, nicht aufzugeben.
Kein Land in der EU zählt mehr Bauern als Rumänien, nirgends sind die Höfe kleiner. Der Bauer Cornel Lascu versucht, nicht aufzugeben. Seine Wurzeln, die legt man nicht ab, sagt er.
Verschnaufen, das geht eigentlich nur beim Heiligen Nikolaus. Wie jeden Sonntagvormittag sitzt der Bauer Cornel Lascu vorne rechts im Männerbereich der Kirche auf einem Holzstuhl mit geschwungener Rückenlehne. So oft hat er hier schon Platz genommen, dass der Lack auf der Sitzfläche abblättert. Während im Altarraum vor ihm der Priester mit sonorer Stimme betet, haben die zahlreichen Gottesdienstbesucher im Hauptschiff das „Herr, Erbarme Dich unser“ angestimmt. Es werfen sich einige der Frauen im Weihrauchnebel auf den Boden und stumm mahnen die goldenen Ikonen von den Wänden herab. Cornel Lascu aber, die Wollmütze in den Schoß gelegt, atmet tief durch. Seit drei Stunden ist er schon da, noch eine Stunde wird die orthodoxe Messe dauern. Dann wird der bullige Mann mit dem ergrauten Haar das Kirchenschiff verlassen. Er wird den Kirchenhügel hinuntergehen, über die Brücke entlang der Schotterstraße nach Hause. Immer dieselbe Strecke, rund einen Kilometer lang, ohne Ampel, ohne Zebrastreifen, ohne Trottoir bis zum Haus, das anstatt einer Adresse nur eine Nummer trägt: 239.
In dem zweistöckigen Gebäude, die Giebelseite traditionell zur Straße gewandt, haben schon seine Großeltern gewohnt. Hier ist Lascu aufgewachsen und hat gemeinsam mit seiner Frau eine Tochter und einen Sohn großgezogen. Im Stall wird auch am Wochenende das Vieh vor den leeren Krippen warten. Doch jetzt, als die Gemeinde zum letzten „Herr, Erbarme Dich“ ansetzt, als die Köpfe der daniederknienden Frauen im Steinboden zu verschwinden scheinen, als der Weihrauch bis in die Stirnhöhlen zieht, hält Lascu inne. Diese Momente gehören ihm. Einmal war er mit den Kindern im Süden: „Damit sie das Meer sehen.“ Doch das ist viele Jahre her. Seine Auszeit vom Alltag beginnt mit den goldenen Heiligenbildern und endet, wenn ihm der silberbestickte Priester die Kommunion reicht. Und nicht nur ihm geht es so.

Die orthodoxe Kirche in Vurpăr ist ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen der Gemeinde. Foto: Mihai Stoica
Die Gemeinde Vurpăr in Siebenbürgen, Zentralrumänien, 30 Kilometer von Hermannstadt entfernt, hat offiziell 2.500 Einwohner. Es sind wohl weniger, wenn man jene wegzählt, die regelmäßig für ein paar Monate nach Deutschland, Österreich und Frankreich gehen. Über drei Hügel führt die einspurige Straße nach Vurpăr, vorbei an Schafsherden, die im senffarbenen Wintergras nach den ersten Trieben suchen, bis zum zweisprachigen Dorfschild neben der Western-Union-Filiale: Vurpăr /Burgberg steht da. Vor der Revolution haben in Vurpăr Siebenbürger Sachsen gelebt, 900 Familien sollen es gewesen sein. Doch sie, deren Vorfahren im 13. Jahrhundert hierherkamen, um in der Pufferzone zwischen West und Ost die Christenheit zu verteidigen, sind auf der Suche nach einem besseren Leben in den 1990er-Jahren in Scharen nach Deutschland ausgewandert. Nur ihre Wehrkirche haben sie dagelassen, deren Turm weiter auf dem höchsten Hügel thront. Seit fast tausend Jahren blickt er auf das Dorf, auf die in Streifen geschnittenen Felder, die beginnen, wo die Gemüsegärten enden, auf die Lebensweise, die die Sachsen, die Rumänen und die Minderheit der Roma im Dorf vereint: die Landwirtschaft.
Auf wenigen Hektaren ziehen die Menschen seit jeher Gemüse, Kohl, Tomaten und Rote Rüben, in Handarbeit melken sie die Kühe. Das Geflügel, es rennt frei auf den Höfen herum. Geschätzt rund ein Drittel der im Land konsumierten Lebensmittel werden von Kleinbauern im Familienbetrieb mit wenig Gerätschaft und viel Muskeleinsatz erzeugt und am Handel vorbei vermarktet. Die Ernte des Landes landet nicht unter Plastikhüllen und Barcodes in den Supermarktregalen, sondern auf den Märkten, waghalsig zu Bergen aufgetürmt, und mit enthusiastischer Stimme beworben. Und in den Armen der Frauen, die in den Ecken eine Handvoll Karotten anbieten, und einen Bund Petersilie dazu. Kein anderes Land der EU zählt mehr Landwirte als Rumänien, jeder dritte lebt hier, und nirgendwo sind die Höfe ähnlich klein. 95 Prozent der dreieinhalb Millionen rumänischen Bauern bewirtschaften weniger als zehn Hektar Fläche, der Großteil weniger als fünf. Ein deutscher Landwirt käme mit zehn Hektar kaum über die Runden. In Vurpăr ist man damit Großbauer.
Cornel Lascu ist das nicht. Der 46-Jährige hat vier Schweine, eine Handvoll Hühner, einige Hektar Felder für das Futtergetreide, seine Frau Daniela kümmert sich um das Gemüsefeld hinter der Scheune. Neben der Scheune, hinter dem Holztor, da aber stehen Lascus Pretiosen, da stehen seine vier „Sensibelchen“, da steht, was dem sonst zurückhaltenden Mann Stolz und Freude ins Gesicht spiegelt. „Pass nur auf. Sie sind schreckhaft“, sagt er noch, bevor er die Holzklinke nach unten drückt und mit beruhigendem „Schhh Schhhh“ über die Türschwelle ins Dunkle tritt. Wuchtige schwarze Köpfe durch Stricke gebändigt lassen vom Heu ab und drehen sich konsterniert nach dem unerwarteten Besuch um: Es sind Wasserbüffel mit dunklen Augen und langgezogenen Hörnern, wie Piratensäbel nach hinten gezwirbelt, mit gedrungenen Rümpfen und quadratischen Hufen, ein jedes Tier fast eine Tonne schwer. Kaum ein Bauer tut sich so etwas heute noch an. Der Büffel tritt, wenn er sich bedroht fühlt, und er setzt seine Hörner ein, wenn es sein muss. Doch weil er den Pflug stärker als das Pferd zieht, weil er Sachen frisst, die sogar die Schweine verschmähen – Maisstängel etwa –, und weil seine Milch mit acht Prozent doppelt so viel Fett wie jene der Kuh enthält, hat man in der Gegend über die Jahrhunderte hinweg an ihm festgehalten.
Wenn viel Arbeit war und noch mehr Mäuler zu stopfen, da kam der Büffel gerade recht. Lascu hat heute einen Traktor, so altersschwach wie funktionstüchtig, seine Büffel stehen ihrer Milch wegen im Stall. Zehn Liter Milch, so viel gibt eine Büffelkuh im Sommer, wenn das Futter saftig ist. Fünf Liter sind es jetzt zu Frühjahrsbeginn. Vom Großvater hat Lascu den Umgang mit ihnen gelernt, zwei Tiere hat er noch von ihm übernommen. Auf Kühe umzusteigen, das käme ihm nicht in den Sinn. „Mit den Büffeln bin ich doch aufgewachsen“, sagt er und schüttelt den Kopf, als er von den Nachbarn erzählt, die sogar den Garten aufgegeben haben. Sich einfach von den eigenen Wurzeln davonstehlen? Das geht doch nicht. Also takten die Tiere seinen Alltag. Vor sechs Uhr morgens hackt er die Maisstängel, schneidet Kartoffeln oder Rüben, füllt Mais in die Kübel. Er füttert die Büffelkühe und melkt sie, da hat der Mann selbst noch nichts im Bauch. Nach dem Mittagessen kommt die zweite Runde. Dazwischen mistet er Stall und Schweinekoben aus, verarbeitet die Milch. Er fegt mit dem Reisigbesen den Hof von Strohresten frei. Er bestellt den Acker, repariert den rostigen Traktor. Er sät im Frühjahr und fährt nach und nach die Ernte ein. Er heut im Herbst und schlachtet die Sau vor Weihnachten im Schnee. Er ruht nie, wenn er will, und immer, wenn er kann.

Zwei Arbeiter füttern Kühe in einem Gebäude, das früher zu einer kommunistischen Genossenschaft gehörte. Ein Teil der Infrastruktur dieser Kooperativen, die es in ganz Rumänien gab, wurde von Kleinbauern für ihre Zwecke übernommen. Andere wurden stillgelegt und dem Verfall preisgegeben. Foto: Mihai Stoica
An diesem Märznachmittag muss noch das Holz für die Heizung eingebracht werden. Was macht all die Anstrengung mit einem Menschen? Liebevoll streicht Lascu einer der Büffelkühe über die knochige Kruppe. „Man muss mögen, was man tut.“ Ein Spruch wie aus einem Kitschkalender, hier in Vurpăr, im Haus 239, bedeutet er Anker und Antrieb zugleich. Die Büffelmilch sichert der Familie täglich Nahrung und Bargeld für Waschmittel und Schulsachen, für Kleidung und Medikamente. Ein paar Leute in Hermannstadt nehmen der Familie die Milch regelmäßig ab. Um über die Runden zu kommen, arbeitet Lascu als Aufseher an zwei Tagen der Woche in einem Museum in der Stadt. Und wenn das Geld gar nicht mehr reicht, verkauft die Familie ein Schwein. Lascus Bruder ist vor wenigen Jahren nach Österreich emigriert und handelt jetzt mit Autoteilen in Klosterneuburg. Doch Lascu ist geblieben. Warum tut sich das einer an?
In Vurpăr ist er nicht der einzige. Viorel Cocoș zum Beispiel, der Tomatenzüchter, dessen Samen Fleischtomaten auf ein Gewicht von einem Kilogramm wachsen lassen und die begehrt sind im Dorf wie Bier und Brezel auf dem Volksfest. Der einem Sachsen 1999 sein Haus abgekauft hat und jetzt im Sachsenhaus auf seine Frau wartet, die in Deutschland auf Saison arbeitet. Oder Johann Sonntag, der sich schon vor vielen Jahren für Rumänien entschieden hat, und dem jetzt nach dem Tod der Frau nur ein stattliches Ross geblieben ist und eine Muttersprache, die hier im Dorf kaum einer mehr versteht. Sie und all die anderen bestreiten den Alltag mit wenig Vieh, wenig Geld, kleiner Ernte und großer Müh. Und nicht nur hier: Fast jeder zweite rumänische Kleinbauer verarbeitet seine Produkte selbst.

Traian Banea hilft Ioan, einem seiner Arbeiter, einen Wagen mit Heu zu beladen, das an die Kühe verfüttert wird. Auch wenn er sich es leisten kann, Arbeiter einzustellen, erfordert die Menge an Arbeit, dass jedes Familienmitglied Hand im Betrieb anlegt. Foto: Mihai Stoica
Doch vor allem die Jüngeren machen nicht mehr mit. Die Zahl der Bauern in Rumänien sinkt, ohne dass der Tod in allen Fällen dem Bauersein ein Ende macht. Oft ist es die Aussicht nach einem einfacheren Dasein, dass die Leute die Höfe aufgeben lässt – vor allem, wenn man nicht wie Lascu in der Nische irgendwie ein Auskommen findet. Und zumindest hier in Siebenbürgen locken Alternativen, ohne dass man gleich das Land verlassen muss. Die Industriebetriebe rund um Hermannstadt, die ausländischen Investoren aus der Automobil- und Elektronikbranche, Bosch, Continental, die Marquardt-Gruppe, sie suchen händeringend nach Arbeitskräften. Sie schicken täglich Shuttle-Busse in die abgeschnittenen Dörfer, um Arbeiter zu holen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis liegt bei weniger als 2,5 Prozent. An Menschen wie Lascu und Cocoș fahren diese Busse vorbei. Wohl auch, weil der Bauch gegen den Kopf gewinnt.
„Wir kennen es halt nicht anders“, sagt Elenoara Banea und die Frauen nicken zustimmend. Zu viert haben sie sich in Baneas Küche versammelt, um Krapfen zu backen. Weil die Gattin des Priesters vor einem Jahr gestorben ist, wird eine Seelenmesse verlesen und die Frauen werden sich hüten, dort mit leeren Händen aufzukreuzen. Seit Mittag drängen sie sich schon um den runden Holztisch im kaum mannshohen Raum. Ein Hirschgeweih sitzt im Herrgottswinkel. Daneben hängen die Heiligen an der Wand, um den Hof zu schützen. Wer sonst soll sich darum kümmern. Der Staat tut es ja nicht. „Schnell, her mit der Serviette“, ruft Elenoara Banea, die von allen nur Frau Norica gerufen wird, als sie den ersten im heißen Fett blasenschlagenden Krapfen aus dem Emailletopf fischt. 150 Stück müssen es werden an diesem Nachmittag, damit man sich bei der Messe nicht schämen muss.
Es ist der späte Winter, der den Frauen die Extraschicht erlaubt. Noch haben sie Zeit, bevor die Aussaat beginnt und Zwiebel, Spinat, Knoblauch, Salat, Radieschen, Kürbis und Petersilie in ihren Gärten wachsen werden. Wie man das Gemüse zieht, wie man die Tiere hält, ihre Lebensweise, all das haben sie an keiner Schule gelernt. Es ist zu ihnen gekommen, durch die Großeltern und Eltern, durch den Lauf der Dinge, der hier langsamer vonstattengeht, ohne stehen zu bleiben. Frau Norica, 60 Jahre alt, mit weißem Pagenkopf und resoluter Stimme, baut Goji-Beeren an und zahlt alle ihre Rechnungen online. Aber sie muss nach draußen gehen, um neue Holzscheite für den Ofen zu holen. Als sie die Tür öffnet, hört man die Perlhühner rufen. Keine Katze vertreibt die Ratten so gut wie ein Perlhuhn, sagt eine der Frauen. „Und kein Gewehr.“
Solchen Regeln folgt das Leben in Vurpăr: Perlhühner gegen Ratten. Bier und Salz gegen Schnecken. Den Dünger rühren die Frauen aus Hühnermist an: Drei Teile Wasser, ein Teil Hühnerkot. 21 Tage Wartezeit. Der wuchtige Steinofen zwischen Wohntrakt und Scheune hat drei Feuerstellen, die Mitte für das Brot, links für den Eintopf und rechts für den Schnaps. Der wird aus der eigenen Ernte gebrannt und brennt höllisch auf seinem Weg in den Magen. Frauen dürfen nur ein Glas davon trinken, so heißt es in ganz Siebenbürgen, sonst werden die Kinder blind.
Überhaupt die Kinder: Vor allem die Jüngeren entscheiden sich gegen das bäuerliche Leben und verlassen Vurpăr, gehen in die Stadt. Wer Glück hat, weiß seinen Nachwuchs im nahen Hermannstadt oder vielleicht in Bukarest, die anderen holen sich Wifi und Skype. Frau Norica hat sich einen eigenen Schreibtisch für die Konferenz mit den zwei Söhnen eingerichtet, der mit den verblassten Fotos der Kinder und den hochaufgelösten der Enkel wie ein kleiner Altar anmutet. Der ältere Sohn ist Arzt in Sevilla, der jüngere macht das Doktorat an der Universität Reykjavik. Der Computer verbindet sie alle, die Mutter mit den Kindern und die Kinder mit der Heimat, die wenig bieten mag, aber Heimat bleibt. Der Ältere hat gar eine Kamera im Hof installiert, damit er manchmal aus der Ferne zuschauen kann, wenn der Pferdeleiterwagen einfährt, um das Heu aus der Scheune zu holen. Wie die braune Stute die einzelnen aufgestobenen Gräser aufpickt, mit ihren fingerdicken Eisenstollen am Huf, wegen der Schlammstraßen, und den roten Stoffbommel am Zaumzeug, gegen den volksmystischen bösen Blick.
Und manchmal reist die Heimat zu ihm: Frau Norica schickt regelmäßig Essenspakete gen Westen. Sie bringt sie zum internationalen Busbahnhof in Hermannstadt. Sie steckt dem Fahrer des Langstreckenbusses Geldscheine zu, damit er das eingelegte Gemüse in bruchsicheren Plastikflaschen mit auf die Reise nimmt. Und wenn es sein muss auch mehr: Zu Ostern ein Lamm, zu Weihnachten ein zerlegtes Schwein: tiefgekühlt durchqueren die Fleischlieferungen einmal ganz Europa. Nicht nur jene von Frau Norica.

Die Frauen in Vurpăr bereiten sich mit selbstgemachten Krapfen auf das traditionelle orthodoxe Osterfest vor. Foto: Mihai Stoica
Kurz nach der Wende erwirtschaftete die rumänische Landwirtschaft mehr als ein Fünftel des rumänischen Bruttoinlandsprodukts, heute sind es noch vier Prozent. Das liegt daran, dass sich die Wirtschaft in Richtung Dienstleistung entwickelt hat. Und am Zustand der rumänischen Landwirtschaft. Überall, bis in die Kleinstädte hinein, stehen Supermärkte mit Importwarte aus Westeuropa, die billiger ist – und vor allem vorhanden. 2016 hatte die rumänische Regierung versucht, mittels eines Gesetzes rumänische Produkte in die Supermärkte zu zwingen. Mindestens 51 Prozent der Lebensmittel in den Regalen sollten demnach aus Rumänien stammen. Das Gesetz scheiterte an den EU-Gesetzen – Brüssel sah den Binnenmarkt außer Kraft gesetzt – und an der Realität: Die rumänische Landwirtschaft hätte die Importware nicht ersetzen können.
Die arbeitsintensive und wenig automatisierte Bewirtschaftung aber, die veralteten Gerätschaften, der geringe Einsatz von Pestiziden: Diese Praxis mag die Natur und Umwelt schonen, konkurrenzfähig ist sie nicht. Und dass sie die dörfliche Kultur weiterträgt und den Menschen bei niedrigen Pensionen und mageren Sozialleistungen ein Sicherheitsnetz bietet, wird knapp eingepreist. EU-Gelder kommen jedenfalls spärlich an. Da die EU-Landwirtschaftspolitik vorrangig Fläche subventioniert und in Rumänien kaum einer viele Hektar besitzt, bleiben die Förderungen mager. Aus den Direktzahlungen, der wichtigsten Subventionssäule, schöpfen rund 90 Prozent der rumänischen Bezieher weniger als 1.250 Euro im Jahr ab. Trotzdem arbeiten in keinem Land der EU mehr Menschen – jeder Vierte – noch immer in der Landwirtschaft.

Bereits früh im Jahr pflügen zwei Traktoren die Felder in den Hügeln rund um Vurpăr. Eurostat zufolge besitzen weniger als zwei Prozent der landwirtschafltichen Betriebe einen eigenen Traktor. Foto: Mihai Stoica
In Vurpăr aber fehlen die Arbeitskräfte. Am Dorfrand, wo die Trampelwege in die ersten Felder ausfransen, wird bald Mais aus dem Boden sprießen und im Frühsommer werden die Luzerne lila blühen. Was den Besucher als siebenbürgische Idylle erwarten wird, birgt Knochenarbeit für die Einheimischen. Die Höfe, so bescheiden sie auch sein mögen, können die Familien alleine nicht bewirtschaften. Sie brauchen billige Hände, auf dem Feld, im Stall und auf der Weide. Tagelöhner, die die fehlenden Maschinen ersetzen und die Viehherden über die Allmende treiben, sie brauchen Hirten für die Alm. Seit die Menschen hier denken können, haben das die Roma im Dorf übernommen. So wie Lascu das Bauernsein von seinen Großeltern gelernt hat, so lernten die Roma-Kinder das Knechtsein von ihren Älteren. Doch seit die Freizügigkeit die Menschen nach Deutschland, Frankreich und Österreich lockt, seit sich zwei-, dreihundert Euro im Westen mit weniger Schweiß und Mühsal verdienen lassen, haben vor allem diejenigen Vurpăr verlassen, die am wenigsten zu verlieren haben. Seit die Roma gehen, nimmt die Arbeit deshalb gar kein Ende mehr.
Nur im Sonntagsanzug dürfen die Hände ruhen. In der Kirche des Heiligen Nikolaus auf dem Hügel hat der Priester sich vor die Gemeinde gestellt und läutet mit der Predigt die Schlussphase des Gottesdienstes ein. Cornel Lascu streckt vorne im Männerbereich den Rücken durch, um sich aufrichten zu können. Frau Norica rückt hinten bei den Frauen ihre elegante schwarze Stola zurecht. Über der Gemeinde hängt eine Glocke aus kaltem Atem, aus dem Dunst dicker Mäntel, aus Weihrauchkegeln. Der Weg zu Gott erfolge freiwillig, erklärt der Priester eindringlich. Und der zum Bauersein? Es wäre schön, meint Lascu, wenn er die Bindung an Tier und Boden an seine Kinder so weitergeben könnte, wie er es selbst erfahren hat. Wenn er ihnen zeigen könnte, was den Menschen mit seinem Land verwurzelt. Die Tochter zeigt Ambitionen, studiert Landwirtschaft in Hermannstadt, ein Glück! Der Sohn ist erst 15, interessiert sich für Religion. Wer weiß. Lascu hat gelernt, dass man den Lauf des Lebens wenig mitbestimmen kann. Es kommt wie es kommen muss. Wenn man Lascu fragt, wovon er träumt, weiß er keine rechte Antwort. Auf die Nachfrage, was er in seinem Leben ändern würde: „Nichts.“ Er zuckt mit den Schultern. Eigentlich hat er sich darüber nie Gedanken gemacht.
Erstmals publiziert am 18. Mai 2018 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf faz.net.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt: © Eva Konzett. Bei Interesse an Wiederveröffentlichung bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Redaktion.
Urheberrechtliche Angaben zu Bildern, Grafiken und Videos sind direkt bei den Abbildungen vermerkt. Titelbild: Traian Banea startet seinen Traktor auf dem Hof. Obwohl der Traktor alt ist, sagt er, dass er für seine Arbeit unerlässlich ist und immer noch gute Dienste erweist. Foto: Mihai Stoica