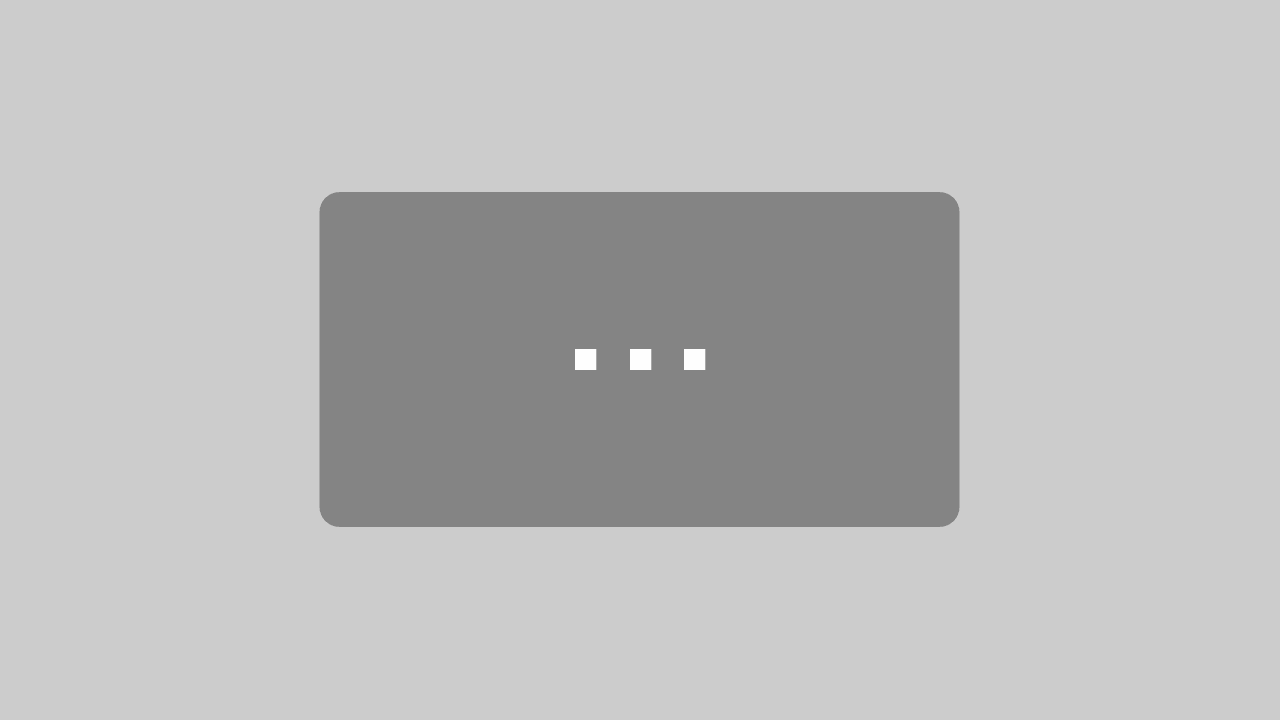Francis Fukuyama: Identitätspolitik
Die Forderung nach Würde und die Zukunft des Nationalstaates
Vor dreißig Jahren fiel der Eiserne Vorhang. Dieses Ereignis eröffnete enorme Möglichkeiten für Einzelpersonen, Staaten und Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. Damals schrieb der heute weltberühmte Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das Buch Das Ende der Geschichte, in dem er vorschlug, dass das Ende des Kommunismus zur Verbreitung der liberalen Demokratie führen würde. Seine Theorien lösen bis heute weitreichende Debatten aus.
Dies ist die Niederschrift des Vortrags von Francis Fukuyama, den er am 7. März 2019 in Wien als ersten von insgesamt vier Tipping Point Talks 2019 der ERSTE Stiftung zum Jubiläum 200 Jahre Sparkassenidee in Österreich gehalten hat.
Transkript
Ich hoffe, ich werde Sie nicht mit einer allzu ausufernden Vorlesung langweilen, und wir freuen uns schon auf die Diskussion. Mein Dank geht an die ERSTE Stiftung und an Sie alle, dass Sie heute Abend hergekommen sind, um über etwas zu sprechen, was in meinen Augen ein ziemlich bedeutsames Problem ist, nämlich die Krise, und zwar, wie ich meine, die globale Krise der Demokratie, die der Aufstieg eines nationalistischen Populismus verursacht hat.
Ich war eigentlich mit anderen Forschungsprojekten beschäftigt: Ich leite ein Zentrum zur Erforschung von Demokratie, Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, darüber nachzudenken, wie wir die demokratische Welt erweitern und mehr Länder demokratisch machen können, sie verbessern und von autoritären zu demokratischen Regierungen gelangen können. Und dann kam plötzlich das Jahr 2016. In jenem Jahr fanden einige sehr bestürzende Ereignisse statt: die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und die Entscheidung Großbritanniens, aus der Europäischen Union auszutreten. Und dies alles vor dem Hintergrund eines sich radikal wandelnden globalen Umfelds.
Über die letzten 30 Jahre hinweg, seit 1989 oder 1991 nämlich, haben wir in einer immer liberaleren internationalen Ordnung gelebt. Diese ist zum Großteil von den USA errichtet worden, gemeinsam mit den Verbündeten in Westeuropa und mit der NATO, im Fernen Osten, und hatte eine ökonomische Komponente, das Freihandelssystem: die Bewegung von Gütern, Menschen, Dienstleistungen, Ideen und Investitionen über internationale Grenzen hinweg. Und sie besaß eine politische Komponente in Gestalt der Bündnisse, die die USA in Europa und Asien geschmiedet haben. Und dies waren wirklich sehr erfolgreiche Projekte.
Die Anzahl der Demokratien wuchs in jener Zeit über die etwa 35 hinaus, die es im Jahr 1970 gab, und erreichte einen Höchststand von etwa 115 bis 120, je nach Definition von Demokratie. Anfang der 2000er Jahre vervierfachte sich die Wirtschaftsleistung der Weltwirtschaft. Die ökonomische Lage wurde in praktisch jeder Hinsicht besser, und zwar nicht nur mit Blick auf die Einkommen oder den Aufstieg der Mittelklasse in Ländern wie China und Indien, sondern auch auf die Gesundheit der Kinder – die Säuglingssterblichkeit ging zurück.
Die ERSTE Foundation Tipping Point Talks 2019
Eröffnung
Boris Marte, ERSTE Stiftung
Vortrag
Francis Fukuyama: Identitätspolitik – Die Forderung nach Würde und die Zukunft des Nationalstaates
Diskussion
Wie fördern wir die Demokratie in Europa 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs?
Alexander Van der Bellen, Präsident der Republik Österreich
Francis Fukuyama, Politikwissenschaftler
Julia De Clerck-Sachsse, EU-Diplomatin
Ivan Krastev, Politikwissenschaftler
Karolina Wigura, Philosophin
Moderation: Almut Möller
All diese Entwicklungen fanden statt und kehrten sich trotzdem irgendwann von Mitte bis Ende der 2000er Jahre um. So kam es etwa zum Aufstieg zweier wieder sehr selbstbewusst und forsch auftretender autoritärer Mächte: Russland und China. Aus meiner Sicht viel beunruhigender war allerdings dieses Aufkommen des Populismus in etablierten Demokratien, ja sogar innerhalb der beiden am stärksten etablierten Demokratien: Großbritannien und den USA. Und mir schien es von großer Wichtigkeit zu sein, zu ermitteln, warum dies geschah und was vor sich ging, weil die ganze dritte Welle der Demokratisierung plötzlich abgewickelt zu werden schien.
Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich als Professor für Politikwissenschaft Sie nun mit ein paar Definitionen konfrontieren muss, da Populismus oft unterschiedlich verstanden wird. Ich will mich auf drei beschränken, weil es wichtig ist, dass man zwischen ihnen unterscheiden kann.
Die erste Definition ist eine ökonomische: Ein Populist ist ein politischer Führer, der eine Wirtschaftspolitik oder Sozialpolitik vertritt, die zwar kurzfristig populär ist, langfristig aber desaströs. So hat zum Beispiel Hugo Chávez in Venezuela Augenkliniken eröffnet und kostenloses Essen verteilt. Das Benzin kostete in Venezuela weniger als zehn Cent pro Gallone. Keine dieser Maßnahmen war nachhaltig: 2014 rauschte der Ölpreis in den Keller. Das ist nun also die ökonomische Definition von Populismus.
Die zweite Definition ist primär politischer Art: Ein populistischer Führer will charismatisch sein und sagt: Ich bin unmittelbar mit euch, den Menschen, verbunden. Und das ist sehr wichtig, denn dies macht einen solchen Populisten, wie ich meine, per se zu einem Feind der Institutionen. Der Populist sagt: Ich repräsentiere euch, die Menschen. Und da drüben sind die ganzen anderen Institutionen wie die Gerichte, die Medien, ein bürokratischer Gesetzgeber, und sie stehen mir alle dabei im Wege, euch das zu geben, was ihr von mir haben wollt. Deshalb blasen die Populisten zur Jagd auf all diese Institutionen. Und dies führt nun dazu, dass der demokratische Bestandteil der liberalen Demokratie den liberalen Teil attackiert. Ihn und sämtliche institutionelle Strukturen, jene Kontrollinstanzen, die die Macht der Exekutive beschränken sollen. Demokratie bedeutet ja nicht nur, dass es öffentliche Wahlen gibt, sondern auch einen Schutz von Minderheitenrechten sowie eine moderate Regierung, die den tatsächlichen Volkswillen angemessen repräsentiert. Populisten neigen zu einer autoritären Politik, weil sie nicht wollen, dass die Institutionen ihnen in die Quere kommen. Um ein Beispiel zu nennen: Als Donald Trump im Jahr 2016 seine Nominierung durch die Republikaner annahm, äußerte er in seiner Grundsatzrede einen interessanten Satz. Er sagte: Nur ich verstehe eure Probleme und nur ich kann sie lösen. Etwas in dieser Art hätte Juan Perón damals im Argentinien der 1940er Jahre sagen können. Es ist genau dieser Personalismus, der wieder in den Vordergrund drängt. Das ist also Nummer zwei.
Die dritte Definition lautet, dass ein Populist dann, wenn er sagt “ich stehe auf der Seite des Volkes”, oft nicht das ganze Volk meint. Er meint vielmehr bestimmte Personen einer bestimmten Rasse oder Ethnie, oft im Sinne traditioneller kultureller Werte oder eines traditionellen Verständnisses nationaler Identität, das durchaus nicht im Einklang mit der tatsächlichen Bevölkerung des betreffenden Landes sein muss. Viktor Orbán in Ungarn hat etwa ausdrücklich verkündet, dass die nationale Identität Ungarns darin besteht, ein ethnischer Ungar zu sein, was bedeutet, dass man der Nation nicht angehört, wenn man kein ethnischer Ungar ist. Ist man andererseits ein ethnischer Ungar, der außerhalb der ungarischen Grenzen lebt – und von denen gibt es viele -, dann ist man Teil der Nation. Und das ist aus, wie ich meine, offensichtlichen Gründen problematisch.
Dies erlaubt uns nun eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des Populismus. Hugo Chávez in Venezuela war zum Beispiel ein klassischer Vertreter des ersten Typus, ein ökonomischer Populist, ein linker Populist. Zudem war er, der zweiten Definition entsprechend, sehr charismatisch. Definition 3 hingegen entsprach er nicht, weil er keine rassische Auffassung davon vertreten hat, wer Venezolaner ist. Ich denke, Orbán fängt wahrscheinlich … Nun, er vertritt eine populistische Wirtschaftspolitik, ist aber gewiss auch bemüht, ein Demagoge zu sein, ein charismatischer Führer. Und er hat gewiss sehr restriktive Ansichten darüber, wer Ungar ist oder als solcher zu gelten hat. Ich denke, uns allen in diesem Raum ist die Litanei der Führer bekannt, jener neuen Führer, die unter diese Kategorie fallen. Das ist Orbán, das ist die Partei Recht und Gerechtigkeit, der polnische Beitrag, das ist Herr Erdoğan in der Türkei. Jetzt haben wir eine populistische Koalition in Italien, während Lateinamerika jetzt seinen ersten Populisten im nordeuropäischen Stil in Gestalt von Jair Bolsonaro gewählt hat. Die meisten lateinamerikanischen Populisten sind wie die Populisten Südeuropas: linksgerichtet, ohne ethnischen Exklusivitätsanspruch und eher Populisten im ökonomischen Sinne. Doch Lateinamerika hat beschlossen, sich den anderen anzuschließen. Man hat dort zudem einen Führer gewählt, der, wie Sie wissen, rassistische Vorurteile hegt und der eine sehr christlich-fundamentalistische Auffassung davon hat, wie Brasilien aussehen sollte. Eigentlich gehört er also gewissermaßen nach Deutschland oder Skandinavien oder in so eine ähnliche Ecke. Das ist also nun in meinen Augen eine Möglichkeit, zwischen Populisten auf der Linken zu unterscheiden, die Nummer eins und Nummer zwei entsprechen, und Populisten auf der Rechten, die eher Nummer zwei und drei sind.
Francis Fukuyama
Francis Fukuyama ist Olivier Nomellini Senior Fellow am Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) und Mosbacher Direktor des FSI Center on Democracy, Development and the Rule of Law. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Stanford University.
In seinem Buch “Das Ende der Geschichte” stellt Fukuyama die These auf, dass mehr Freiheit und Wohlstand automatisch zur Forderung nach demokratischer Regierungsführung weltweit führen würden. Und doch scheinen die Wege zu sozialem und wirtschaftlichem Wohlstand in vielerlei Hinsicht entkoppelt. Wie kam es dazu? Ist Identitätspolitik in der heutigen Europäischen Union eher ein Hindernis oder vielmehr ein Schritt zur Erfüllung einer nationalen Vision?
Foto: © ERSTE Foundation / eSel
Das ist jetzt also die Art von Phänomen, die wir erklären wollen. Speziell den Aufstieg der Rechtspopulisten, und zwar aus Gründen, auf die ich gleich noch kommen werde. Die Frage lautet dann also, warum es zu diesen Dingen ausgerechnet in der Mitte des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts kommt. Ich glaube, dass die Gründe dafür in drei generelle Kategorien fallen. Die erste entspricht meiner Meinung nach der landläufigen Meinung zu diesem Thema, der zufolge es an der globalen Ökonomie liegt. Wenn Sie an der Uni ein Seminar zum Thema Handel belegen, dann lernen Sie, dass ein System des Freihandels die Einkommen aller Beteiligten erhöht. Alle werden reicher. Wie ich bereits erwähnte, hat sich die globale Wirtschaftsleistung über 30 Jahre hinweg vervierfacht. Die Ökonomen lagen diesbezüglich zwar nicht falsch, doch wenn Sie Ihrem Ökonomieprofessor oder Ökonomieprofessorin genau zuhörten, dann hörten Sie sie oder ihn sagen: Nicht jeder Einzelne, nicht jedes Individuum in jedem Land wird reicher. Und in der Tat: Wenn Sie ein geringqualifizierter Arbeiter mit wenig Bildung in einem wohlhabenden Land sind, dann werden Sie gegenüber einem ähnlich qualifizierten Arbeiter in einem armen Land womöglich das Nachsehen haben. Und genau so etwas ist ja tatsächlich geschehen: Durch Outsourcing und ausländische Wettbewerber hat dieses globalisierte Freihandelssystem, das in den 1990er Jahren nach dem Mauerfall so richtig Fahrt aufgenommen hat, zum Export vieler Arbeitsplätze aus der reichen Welt geführt. Außerdem hat es zum ökonomischen Niedergang eines wichtigen Teils der alten Arbeiterklasse geführt. In den USA zum Beispiel ist zwischen Ende der 1990er Jahre und dem Jahr 2015 das Durchschnittseinkommen derjenigen in den unteren 90 % der Einkommensverteilung faktisch leicht zurückgegangen. Das ist wirklich bemerkenswert: Da gab es zwei ganze Jahrzehnte, in denen die Menschen de facto Einkommensrückgänge zu verzeichnen hatten. Dieses Problem war übrigens für die Männer in gewisser Weise doppelt schlecht. Es gab hier nämlich bedeutende geschlechtsspezifische Unterschiede, denn eine Sache, die sich parallel dazu abgespielt hat, war, dass wir von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsökonomie übergangen sind, in der die Frauen von Haus aus eine größere Rolle spielen.
So kam es, dass ein männlicher Fabrikarbeiter, der seinen Job verloren hat, dann beim Burgerbraten in einem Fast-Food-Restaurant weniger Geld verdient hat, weniger Geld als sein Vater und vielleicht sogar sein Großvater, und seine Frau oder Freundin dann der Hauptverdiener in der Familie war. Das bedeutete also große Einkommens- und auch Statuseinbußen. So lautet also, wie ich sagen würde, die landläufige Auffassung, die erklären soll, warum sich die Dinge so entwickelt haben.
Eine zweite Kategorie von Gründen hat mit Politik zu tun. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Vorwurf an die Demokratie lautet, dass sie schwache Regierungen hervorbringt. Demokratien könnten keine Entscheidungen treffen. Da seien die Parlamente, die redeten, wo immer alle nur quasselten, da seien Koalitionen, da seien Interessengruppen, da sei der Lobbyismus, und all das mache es wirklich schwer, Entschlusskraft zu entwickeln. Daher gibt es unter den normalen Leuten ein starkes Verlangen nach einem starken Mann, einem Anführer, der diesem „Gefasel“ ein Ende setzt, Entscheidungen trifft und die Sache erledigt. Und wir in den USA sind aus irgendwelchen Gründen der Meinung, dass reiche Unternehmertypen genau diese Art von Führungspersönlichkeiten sind. Daher gab es bei uns diese Tendenz dazu, Geschäftsleute zu politischen Führern aufzubauen. Ich bin der Meinung, dass ein Konzernvorstand zu sein ungefähr die schlechteste Vorbereitung darauf sein dürfte, ein demokratischer politischer Führer zu werden, da große Unternehmen eigentlich ziemlich autoritär organisiert sind. Besonders Familienunternehmen sind in dieser Hinsicht unglaublich. Diese sind, nun ja – sie werden von lauter kleinen Königen gelenkt, und das ist in der Tat kein besonders gutes Führungstraining. Trotzdem hatten wir eine Reihe von Leuten, die – vor dem Hintergrund einer schwachen Regierung – gewählt worden sind, weil die Leute dachten, diese müssten wirklich zäh sein. Denken Sie an Abe in Japan, Modi in Indien, Donald Trump in den USA… Das ist also ein weiterer Grund.
Der dritte ist hingegen kultureller Art, und das ist der, der mit Identität zu tun hat. Darum geht es auch in meinem jüngsten Buch. Ich glaube, dass es eine Tendenz dazu gab, die Relevanz der ökonomischen Triebkräfte zu überschätzen und die Bedeutung der kulturellen Dimension des Ganzen nicht vollständig zu würdigen, die Tatsache nämlich, dass wir es hier letztlich mit einem Identitätskampf zu tun haben. Was ist also Identität? Das Wort Identität und Identitätspolitik war bis in die 1950er Jahre hinein im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht verankert. Soweit ich weiß, war ein Psychologe namens Erik Erikson der Erste, der diesen Ausdruck verwendet hat, wobei er eigentlich ein sehr alter Begriff ist. Und wie ich in meinem Buch behaupte, geht er auf ein griechisches Wort zurück, das Platon in seinem “Staat” verwendet hat: “Thymos”. Thymos ist der Teil der Seele, der nach Achtung und Anerkennung ihres Wertes verlangt. Wir wollen eben nicht nur materielle Dinge wie Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf und so weiter. Wir wollen auch, dass uns andere wertschätzen, in dem Maße, von dem wir glauben, dass wir es verdienen, und ich denke – die Ökonomen im Raum mögen es mir bitte nachsehen -, ich denke also, dass die Ökonomen ein zu engstirniges Verständnis des menschlichen Verhaltens haben, weil sie sagen, okay, die Menschen haben Bedürfnisse, sie haben Präferenzen und sie sind rational und nutzen ihre Rationalität zur Maximierung ihrer Präferenzen. Und das erklärt, warum Menschen das tun, was sie eben tun. Blickt man nun aber erneut auf den “Staat”, dann sagt Sokrates: Das stimmt nicht. Da ist noch dieser dritte Seelenteil, dem es nicht primär um materielle Güter geht, sondern der nach Achtung verlangt, und dies übertrumpft in vielen Fällen das Bedürfnis nach materiellem Wohlergehen, da Achtung an die Emotionen gekoppelt ist. Wenn man nicht in dem Maße geachtet wird, in dem man glaubt, es zu verdienen, dann wird man wütend, und das treibt einen dann zur Gewalt, zur Politik und zu vielen anderen Dingen.
Das moderne Verständnis von Identität ist nun ein klein wenig anders gelagert. „Thymos“ ist eine universelle menschliche Eigenschaft, alle Menschen haben sie in gewissem Umfang, und es gab sie in jeder geschichtlichen Periode. Es gibt allerdings ein spezifisch modernes Verständnis von Identität, das meiner Ansicht nach seinen Anfang mit Martin Luther genommen hat. Luther hat nämlich gesagt: In den Augen Gottes, was Gott interessiert, das ist deine innere Überzeugung, dein innerer Glaube. Gott schert sich nicht um – es ist einfacher, diesen Punkt in einem protestantischen Land zu machen, wie vor ein paar Tagen in Hamburg, als hier in Wien, aber nun gut –, Gott also interessiert sich nicht für die ganzen Rituale der katholischen Kirche. Ihn kümmert es nicht, ob man den Rosenkranz betet oder in die Messe geht oder so etwas, ob man den Regeln folgt, die die katholische Kirche vorgibt, denn Gott interessiert sich nur für den innerlich Gläubigen, und nur als solcher wird man errettet werden. Das macht den christlichen Glauben aus. Und die ganze Gesellschaft um einen herum kann falschliegen und irren und unterdrückerisch sein, weil sie die Authentizität jenes inneren Selbst, das den Gläubigen auszeichnet, leugnet, und der Einzige, der es erkennen kann, ist – man vielleicht selbst auch, vor allem aber Gott: denn es lässt sich nicht am äußeren Verhalten ablesen. Dies begründet in gewisser Weise das moderne Verständnis von Identität, das besagt, dass wir einen inneren Wert haben, der der Bewertung übergeordnet ist, die wir von der uns umgebenden Gesellschaft erhalten. Zu anderen, vormodernen Zeiten hätte man gesagt: Tja, Pech gehabt. Du musst dich anpassen. Die Gesellschaft gibt die Regeln vor, also werde erwachsen und sieh ein, dass du diese Regeln befolgen musst. Die moderne Fassung hingegen besagt: Nein, das ist nicht wahr, denn was hier von Wert ist, ist jenes innere Selbst, und der Rest der Gesellschaft liegt falsch, und deshalb ist sie es, die sich ändern muss. Es gibt dann noch spätere Variationen dieses Gedankens, besonders bei Jean-Jacques Rousseau, der sagt, dass der ganze Verlauf der Geschichte uns eigentlich zu Heuchlern gemacht hat, dass er diese äußerlichen Regeln geschaffen hat, Regeln, die das eigene Selbst unterdrücken. Der Zweck, der uns erfüllt, besteht aber darin, jenes authentische innere Selbst zum Vorschein kommen zu lassen.
Wenn man sich dies vor Augen hält, dann merkt man, dass dieser Gedanke der Struktur vieler moderner sozialer Bewegungen entspricht. So hat meines Erachtens etwa die Me-Too-Bewegung gewissermaßen dieselbe Struktur, was die Wertschätzung des inneren Selbst angeht. Was ist denn das Problematische an sexueller Belästigung? Es hat damit zu tun, dass Männer Frauen eben nicht als Menschen im umfassenden Sinne respektieren. Frauen besitzen Wissen, Fertigkeiten und Charakter. All diese Eigenschaften. Die Männer interessieren sich aber nur für ihre geschlechtlichen Eigenschaften, und das entwertet die Frauen. Dies ist jedoch eine moderne Ansicht, weil die Folgerung, die man aus diesem Umstand zieht, nicht lautet, dass die Frauen einfach nur lernen müssen, wie sie damit klarkommen. Die Lektion lautet vielmehr, dass es das innere Selbst ist, das wertvoll ist, und dass sich die ganze Gesellschaft im Außen verändern muss, was ja gerade auch geschieht. Die Männer machen also gerade eine kulturelle Umschulung durch. Sie lernen, dass ihre Regeln in Wahrheit nicht die richtigen sind, und dass wir andere Regeln für die Beziehungen zwischen Männern und Frauen brauchen, die die Würde der ganzen Person in diesen Beziehungen achten. Das ist also die moderne Auffassung von Identität, die eine ganze Reihe von politischen und sozialen Bewegungen in den letzten 200 oder 300 Jahren befeuert hat.

Foto: © APA / Ludwig Schedl
Die erste Manifestation von Identitätspolitik ist, wenn Sie meiner Interpretation folgen, eigentlich die Demokratie selbst. 2011 war da dieser Gemüsehändler, Mohamed Bouazizi, in Tunesien. Er hatte einen Gemüsewagen, der von einer Polizistin beschlagnahmt wurde. Er ging dann zum Sitz des Gouverneurs und fragte: “Wo ist mein Wagen, warum habt ihr mir mein Auskommen genommen?” – Niemand antwortete ihm. Die Polizistin hat ihn angespuckt, und er war so verzweifelt, dass er nicht einmal eine Antwort von der Regierung bekommen hat, dass er sich angezündet hat. Diese Tat löste den Arabischen Frühling aus, denn viele Leute in den arabischen Ländern – die zum damaligen Zeitpunkt allesamt Diktaturen waren – erkannten sich in Mohamed Bouazizi wieder. Die tunesische Regierung, die Diktatur von Ben Ali, behandelte ihn nicht einmal mit dem Mindestmaß an Achtung, das ein Mensch verdient. Deshalb gingen sie zu Millionen auf die Straße, in Libyen, Ägypten, Syrien, im Jemen und vielen anderen Teilen der arabischen Welt, weil autoritäre Regierungen keine Achtung vor ihren Bürgern haben. Bei gemäßigt autoritären Regierungen wie etwa in Singapur gilt, dass sie ihre Bürger wie Kinder behandeln, nach dem Motto: Die Regierung weiß besser, was in eurem Interesse liegt, und ihr seid nicht reif genug, um diese Entscheidung selbst zu treffen. Deshalb müssen wir euch führen. In einer sehr ausgeprägten Diktatur ist es viel schlimmer: Man ist kein Mensch, sondern nur Kanonenfutter oder bloß ein Rädchen im Getriebe der Geschichte, das die Regierung für ihre eigenen Zwecke einspannen kann. Die liberale Demokratie hingegen erkennt uns tatsächlich an, unsere Würde, und das tut sie, indem sie uns mit Rechten ausstattet: Wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit, auf freie Versammlung und letztlich auf politische Teilhabe durch Wahlen. Wir haben Anteil an unserer eigenen Selbstregierung, weil die Regierung uns genügend respektiert, um uns Dinge wie etwa das Wahlrecht anzuvertrauen.
Dies liegt also der Demokratie zugrunde, die wir, denke ich, alle wertschätzen, und diese Grundlegung erfolgt auf Basis einer universellen Anerkennung der Bürger als moralisch gleichwertig. Sie sind gleiche Akteure. Alle Menschen sind gleich geschaffen, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt. Es gibt allerdings noch andere Formen von Anerkennung, die partieller und eigentlich historischer Art sind. Diese universelle, liberale Form der Anerkennung konkurrierte von Anfang an mit der anderen maßgeblichen Form von Anerkennungspolitik, dem Nationalismus. Tatsächlich bestanden seit der Französischen Revolution beide Stränge parallel. Einerseits ging es bei der Französischen Revolution um die Menschenrechte und deren Verbreitung in der ganzen Welt. Auf der anderen Seite war sie aber auch eine Manifestation des französischen Nationalismus. Sie war die erste moderne Nationalbewegung. Die Franzosen wollten ihr Land gegen die einfallenden europäischen Mächte verteidigen, die Fremden hinauswerfen und ein Land haben, das unter ihrer eigenen Kontrolle steht. Tatsächlich lag dieses liberale Verständnis von Anerkennung das ganze 19. Jahrhundert hindurch mit der nationalistischen Interpretation im Widerstreit. In Deutschland gab es, und hier in Wien 1848, eine liberale Revolution, aber auch eine nationalistische Revolution im Namen des deutschen Volkes. Und diese beiden Auffassungen von Anerkennung haben die deutsche Geschichte tatsächlich von jenem Zeitpunkt an bestimmt. Am Ende hat sich dann eine äußerst aggressive und intolerante Form des Nationalismus in vielen Ländern etabliert, was zu der Katastrophe der beiden Weltkriege des frühen 20. Jahrhunderts geführt hat. Dies ist also eine frühe Form von Identitätspolitik, und es ist genau dieses nationale Verständnis von Identität, das gerade in vielen Ländern wiederkehrt.
Ich würde nun behaupten, dass auch der Islamismus so aufgefasst werden kann, dass er eine Suche nach Anerkennung darstellt. Und dies betrifft meiner Meinung nach in besonderer Weise viele der jungen europäischen Muslime, die in den Krieg gezogen sind für Al-Qaida oder im Namen des Islamischen Staats, weil sie in einem echten Identitätskonflikt gesteckt haben. Diese jungen Leute stammten aus Familien, die nach Frankreich eingewandert sind oder in die Niederlande oder nach Deutschland. Sie fühlten sich nicht wohl mit der Art der Religiosität ihrer Eltern und fanden diese zu altmodisch und zu traditionell. Gleichzeitig fühlten sie sich aber auch nicht hinreichend integriert in die Gesellschaft, in der sie lebten. Sie litten daher unter dieser Art von Entfremdung und konnten die Frage “wer bin ich wirklich?” für sich nicht beantworten. Und die Islamisten kommen dann und sagen: Ich werde dir sagen, wer du bist. Du bist ein stolzer Moslem, du bist Teil einer großen Umma, wir werden überall auf der Welt verfolgt und verachtet, und du kannst etwas dagegen tun, nämlich dich uns anschließen und zurückschlagen und den Islam wieder zu einer stolzen Zivilisation machen. Gut, ich glaube, diese Einschätzung ist wirklich kompliziert, denn ich denke, dass der Islamismus zum Teil tatsächlich durch echte Religiosität motiviert ist und Frömmigkeit, aber auch, dass er weithin vom Wunsch angetrieben wird, herauszufinden, wer man ist und die Art von Identität anzunehmen, die einen mit einer Gemeinschaft vereint, die einem eine Heimat und ein Gefühl der Zugehörigkeit gibt. Dies sind meiner Meinung nach nun alles verschiedene Formen des Anerkennungskampfes.
Eine davon, die in den liberalen Gesellschaften im Lauf des 20. Jahrhunderts entstanden ist, bringt es uns näher, was sich aktuell in unserer Gegenwart ereignet. Und das ist die Identitätspolitik, die die Leute meinen, wenn sie sich über Identitätspolitik beschweren. Ihre Anfänge liegen in vielerlei Hinsicht im Amerika der 1960er Jahre, wo es eine Reihe wichtiger sozialer Bewegungen gab: Die Bürgerrechtsbewegung für die Afroamerikaner, die feministische Bewegung, Bewegungen für behinderte Menschen oder die LGBT-Bewegung. Sie alle repräsentierten Gruppen, die von der Mehrheitsgesellschaft marginalisiert worden sind. In den frühen 1960er Jahren war diese weiß und männlich. Und keine dieser Gruppen hatte einen Platz in dieser Gesellschaftsordnung, und so kam es zu einem sozialen Gerechtigkeitskampf um Anerkennung und dann auch um echten Ausgleich in Form eines Zugangs zum Arbeitsmarkt, rechtlicher Gleichbehandlung und so weiter. All diese Bewegungen haben auf echte soziale Missstände reagiert und spielten eine große Rolle dabei, sie abzustellen, zum Beispiel die Rassentrennung in den USA. Im Zuge der Entstehung der gegenwärtigen Form von Identitätspolitik ist es jedoch zu einem Wandel in der Art und Weise gekommen, wie die linken Parteien über Ungleichheit denken. Im 20. Jahrhundert betrachtete man sie oft – besonders in Europa – durch eine marxistische Brille, wonach der entscheidende Kampf derjenige zwischen Kapitalisten und Proletariat sei. Und das Proletariat bestand damals in den meisten entwickelten Gesellschaften aus weißen Menschen, ja eigentlich aus weißen, männlichen Arbeitern. Diese waren der Gegenstand der Linken, die Gruppe, der die Linke helfen wollte. Mit der Zeit wandelte sich das Verständnis von Ungleichheit dahingehend, jenen spezifischen Gruppen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Oft waren damit etwa Frauen gemeint, ethnische Minderheiten oder sonstige diskriminierte Gruppen. Und damit begannen viele linke Parteien, ihren Bezug zur alten weißen Arbeiterklasse zu verlieren, die damals im 20. Jahrhundert ihre Hauptunterstützerin war. In den USA der 1930er Jahre etwa stimmten in der Zeit von Roosevelts New Deal etwa 80 % der weißen Landbewohner im Süden für die Kandidaten der Demokratischen Partei. Sie wählten die eher linksgerichteten Kandidaten, weil diese Umverteilung betreiben und ihnen wirtschaftlich helfen würden. Doch als sich der Begriff der Ungleichheit eher in Richtung Identität zu bewegen begann, verloren die Demokraten zusehends den Kontakt zu jener alten weißen Arbeiterklasse. Und diese fing dann an, zu den Republikanern überzulaufen. Das war der eigentliche Grund dafür, dass Ronald Reagan in den 80er Jahren gewählt worden ist. Denn er hat die Wähler aus der weißen Arbeiterklasse auf eine Weise angesprochen, wie es frühere republikanische Kandidaten nicht getan haben. Etwas ähnliches passierte auch in Europa mit einer Linken, die entweder sehr auf Umweltfragen konzentriert war oder eben auf diese Art von – Ja, Identitätsfragen waren damals noch etwas anders gelagert in Europa; es ging bei ihnen oft um Einwanderer oder andere diskriminierte Klassen. Und etwas sehr Ähnliches ereignete sich dort, wo die weiße Arbeiterklasse bisher Hauptunterstützerin zum Beispiel der Kommunistischen Partei Frankreichs war. Viele dieser Leute wählten daraufhin den Front National oder andere rechte Parteien. Und dies hat dann zu unserer Gegenwart geführt.

Foto: © Marcel Billaudet / ERSTE Stiftung
Ich möchte eine Sache ganz klar sagen: Viele haben mir vorgeworfen, die Linke für den Aufstieg des rechten populistischen Nationalismus verantwortlich zu machen, was ich aber nicht tue. Ich möchte nur eine Geschichte davon erzählen, was sich in der Entwicklung unserer Art und Weise, über links und rechts nachzudenken, ereignet hat. Es gibt viele Gründe dafür, dass es diesen rechten Flügel gibt, und die ökonomischen zählen in jedem Fall dazu. Es gibt also viele Faktoren, die dieses Phänomen entstehen ließen, und einer davon waren Anleihen am Begriff der Identität, die Leute auf der Rechten bei Vertretern seiner linken Fassung gemacht haben. Wenn Sie vor 50 Jahren in Amerika ein Weißer waren, haben Sie einfach gedacht: Tja, ich bin … Ich will sagen, Sie hätten sich nicht einmal selbst als weiße Person verstanden. Sie hätten gesagt: Ich bin Amerikaner, denn das ist das, was ein Amerikaner ist. Heute haben wir diese weißen Nationalisten, die sagen: Nein, in Wirklichkeit gehöre ich einer Minderheit an, die von den Eliten diskriminiert wird. Ich gehöre also einer Gruppe an, die in Wahrheit überhaupt nicht privilegiert ist. Das wird mir nur unterstellt, und zwar von Leuten, die wirklich privilegiert sind, nämlich diesen ganzen schlauen Leuten an den Unis und in den Medien und so weiter. Identität, dieses Framing von Identität, hat sich also, wie ich glaube, von der Linken zur Rechten verlagert. Nicht die Linke verursacht dies, sondern es ist vielmehr eine gemeinsame Auffassung von Viktimisierung, die von links nach rechts gewandert ist.
Was ich in meiner Schilderung des Aufstiegs der populistischen Rechten und der Leute, die populistische Parteien wählen, betonen möchte, ist, dass es in einem gewissen Umfang zutreffend ist, wenn man sie für missachtet und übergangen hält. Viele Menschen neigen dazu zu sagen, dass diese ganze Gruppe der populistischen Wähler einfach aus Rassisten und Fremdenhassern besteht. Das sind Weiße, die in ihren Gesellschaften bisher tonangebend waren, ihre dominante Stellung jetzt aber verlieren, verärgert sind über diesen Verlust und einfach versuchen, ihre alte soziale Position zurückzubekommen. Und für eine bestimmte Gruppe von Menschen in dieser Kategorie trifft das auch zu. Ich glaube aber, dass es darauf ankommt zu verstehen, dass sie einen Punkt haben, dass sie eben wirklich von den Eliten missachtet und übergangen worden sind. Nachvollziehbar wird dies vielleicht, wenn man sich zum Beispiel ansieht, was mit der weißen Arbeiterklasse in den USA geschehen ist. Ein Gutteil von ihr ist, wie die schwarze Arbeiterklasse, in eine Art gesellschaftliches Chaos gestürzt. Daher gibt es heute unter den geringqualifizierten weißen Arbeitern so einen gewaltigen Zuwachs an Alleinerziehenden, eine steigende Kriminalitätsrate in ihren Wohnvierteln, eine Opiumkrise, in deren Verlauf über 70 000 Amerikaner gestorben sind, und einen Rückgang der Lebenserwartung unter den Männern, den weißen Männern in den USA, in den vergangenen Jahren. Man kann daher eigentlich kaum behaupten, dass diese Leute nicht tatsächlich in einem bestimmten Sinne äußerst schlecht abschneiden sozusagen. Doch was die Leute in Wahrheit aufregt, ist meiner Meinung nach der kulturelle Aspekt. Es gibt ein sehr schönes Buch mit dem Titel “Fremd in ihrem Land”, verfasst von der Soziologin Arlie Hochschild, die in Berkeley lehrt. Diese hat viele Tea-Party-Wähler im ländlichen Louisiana interviewt und hat diese Metapher, die zentrale Metapher ihres Buches, die lautet: Diese Leute sehen sich selbst so, als würden sie in einer Schlange anstehen und in der Ferne ist eine Tür, über der geschrieben steht: “Der amerikanische Traum”. Und sie warten alle darauf, durch diese Tür namens “Der amerikanische Traum” zu gehen. Sie gründen Familien, gehen jeden Tag zur Arbeit und plötzlich sehen sie Leute, die sich vor ihnen in die Schlange drängeln. Ein paar davon sind schwarz, ein paar davon sind Frauen, ein paar sind Schwule und Lesben und ein paar andere syrische Flüchtlinge. Und die Leute, die ihnen beim Vordrängeln helfen, sind im Grunde, offen gesagt, Leute wie Sie und ich, wie diese Zuhörerschaft hier: Es sind gebildete Menschen, Leute aus der Kunst oder aus den Medien und aus den beiden politischen Parteien, die sie weithin ignoriert haben. Und ich denke, einen Widerhall davon kann man auch hier in den populistischen Bewegungen Europas vernehmen, dass es nämlich einen kulturellen Snobismus der gebildeten, kosmopolitischen, kultivierten Großstädter gibt, die in den modernen Gesellschaften die Eliten stellen, und der gegen die Menschen gerichtet ist, die weniger gebildet und keine Großstädter sind und die viel traditionellere soziale und kulturelle Werte haben. Es gibt daher in meinen Augen ein gewisses Quantum an gerechtfertigter Empörung über diese Art von Missachtung.
Das ist nun also die Lage. Ich glaube, dass die kulturelle Triebfeder, die in der Furcht davor besteht, dass uns die Einwanderer unsere nationale Identität wegnehmen, die von Leuten auf der populistischen Rechten zum Ausdruck gebracht wird, ein Thema ist, das praktisch alle neuen populistischen Bewegungen eint. Dass Einwanderung ein so großes politisches Thema für sie ist, liegt eben daran, dass sie glauben, sie selbst hätten die nationale Identität lange Zeit bestimmt und jetzt eben nicht mehr, und dass nationale Identität heute untergraben wird, und zwar nicht nur von den Einwanderern, sondern auch von den Eliten, die sie unterstützen und die wollen, dass diese Einwanderer ins Land kommen. Damit ist der politische Streit umrissen, der uns erwartet.
Wir werden hier gleich ein Panel haben. Man kann viel dazu sagen, was man dagegen tun könnte. Das ist eine naheliegende Frage, die mir ziemlich häufig gestellt wird. Ich habe zwar ein paar Ideen, doch letztendlich ist das eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass man nicht anfangen kann, das Problem zu lösen, bevor man es nicht angemessen analysiert hat. Versuchen wir, mit einigem Wohlwollen zu verstehen, was die Leute tatsächlich dazu bringt, solche Parteien zu wählen. Es geht um sehr viel, denn ich denke, dass hier tatsächlich die liberale Demokratie selbst auf dem Spiel steht. Diese Parteien sind keine Gefahr für die Demokratie – viele von ihnen werden schließlich vom Volk gewählt –, sondern für die liberale Demokratie, für einen an Gesetzen und Verfassungsnormen orientierten Rechtsstaat, der politische Macht begrenzt. Dieser ist in Ungarn und in Polen erodiert, und ebenso in den USA, wo Donald Trump das FBI, die Geheimdienste und die freie Presse als Feinde des Volkes beschimpft. Das ist das, was für uns alle auf dem Spiel steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf die folgende Diskussion.
Dieser Text ist das Transkript eines Vortrages, der anlässlich der Tipping Point Talks 2019 der ERSTE Stiftung am 7. März 2019 in Wien gehalten wurde.
Aus dem Englischen von Frank Lachmann.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt: © Francis Fukuyama. Bei Interesse an Wiederveröffentlichung bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Redaktion.
Urheberrechtliche Angaben zu Bildern, Grafiken und Videos sind direkt bei den Abbildungen vermerkt. Titelbild: Francis Fukuyama bei den ERSTE Foundation Tipping Point Talks 2019. Foto: © Marcel Billaudet / ERSTE Stiftung