“Eine konstruktive Haltung gegenüber allem, was ich tun sollte.”
Interview mit Kuratorin Judit Angel.
Judit hieß mich herzlich in den Räumlichkeiten willkommen, die sie koordinierte, und war offen für meine Fragen über ihren konsequenten und kohärenten Weg. Ich bekam Einblick in ihre persönliche Herangehensweise, um deren wesentliche Koordinaten – Zeit, Raum und sozialer Kontext – Intervention und kritischer Diskurs Gestalt annehmen.
Warum haben Sie sich entschlossen, Kuratorin zu werden? Gab es einen Schlüsselmoment, der Sie dazu veranlasste, diesen Weg einzuschlagen?
Die kuratorische Arbeit war für mich keine Entscheidung, sondern ein Prozess. Ich war 16 Jahre alt, als ich mich entschied, Kunstgeschichte zu studieren, weil ich Kunsthistorikerin werden wollte. An der Universität in Bukarest erhielt ich eine Ausbildung zur Museographin. Ich landete schließlich im Kunstmuseum in Arad, wo ich zunächst mit der Kunstsammlung befasst war, zu der dekorative Kunst ab dem 19. Jahrhundert zählte. Natürlich war ich mehr am 20. Jahrhundert interessiert. In einem ersten Schritt ergänzte ich die Sammlung des Museums um rumänische Kunst ab den 1980er-Jahren, die ich auch im Rahmen von Sequences. ’80s art in Romania ausstellte.
Dann wurde mir klar, dass ich die Dinge auch anders angehen konnte und dass ich eigentlich am liebsten mit lebenden KünstlerInnen arbeiteten wollte. Deshalb organisierte ich eine Ausschreibung für Art Unlimited srl, auf die viele KünstlerInnen aus dem ganzen Land antworteten. Die Ausstellung fand 1994 statt. Etwa zeitgleich wurde ich Museumskuratorin. Damals, 1994, war der Begriff „Kurator” in Rumänien noch neu. Er wurde in der Kunstszene erst nach 1989 verwendet. Meine Entwicklung als Kuratorin war deshalb ein komplexer und kontextbezogener Prozess.
1996 kuratierten Sie die Ausstellung The Museum Complex. Das Konzept knüpfte an die damaligen institutionellen Bedingungen an. Welche Wirkung hatte das Projekt? Wie wurde es Ihrer Meinung nach aufgenommen?
Ich muss vorausschicken, dass ich zur Eröffnung der Ausstellung viele Menschen aus dem ganzen Land einlud, auch aus dem Ausland, aus Österreich und Ungarn. Es war ja eine rumänisch-österreichische Veranstaltung. Sie wurde in erster Linie von einer Gruppe von Spezialisten wahrgenommen (KünstlerInnen, KuratorInnen, KunsthistorikerInnen). Die Kunstwelt ist sehr klein. Aber die überwiegende Mehrheit der Rumänen, die eine Ahnung von solchen zeitgenössischen Kunstdiskursen hat, hat sie gesehen, abgesehen vom Publikum in Arad, das das Museum entweder besuchte oder auch nicht – denn genau darum ging es in der Ausstellung: Das Museum war isoliert.
„Ich war schon immer an der Dynamik der Kunstszenen interessiert, gerade weil ich als Kuratorin von Beginn an mit Institutionskritik zu tun hatte: Mich interessiert die Verbindung zwischen Kunst und Soziologie.“
Aus diesem Grund lag die Institution selbst auf dem Seziertisch. Ich würde nicht sagen, dass sie eine sehr große Auswirkung hatte. Das Internet war ja damals noch nicht so weit verbreitet, also gab es keine Möglichkeit, Veranstaltungen so wie heute zu bewerben. Aber es war gut, dass sie Eingang in die fachlichen und kunstgeschichtlichen Diskurse gefunden hatte. Die Ausstellung Museum Complex wurde kürzlich in Cristian Naes 2016 veröffentlichter Studie zur Institutionskritik in Rumänien in den 1990er-Jahren erwähnt.“Between the “transitional” discourse and the “normal” one. Trends in institutional critique in the Romanian art of the nineties”, in Art in Romania during 1945 – 2000. An analysis from the perspective of the present, herausgegeben von New Europe Foundation, Bukarest / UNArte publishing, Bukarest / MNAC, Bukarest, 2016. Im Gegenzug wurde ich eingeladen, diese Ausstellung sowie Überlegungen zur Institutionskritik in Rumänien in verschiedenen Foren in Budapest und Berlin zu präsentieren.
Judit Angel
Judit Angel ist eine Vorreiterin unter den KuratorInnen Rumäniens. Ihre Karriere begann in den 1980er-Jahren im Kunstmuseum in Arad. Später war sie für längere Zeit für Műcsarnok / Kunsthalle tätig; derzeit ist sie Direktorin von tranzit.sk in Bratislava.
Worin bestanden 1999 die größten Herausforderungen, als sie den rumänischen Pavillon bei der Biennale von Venedig mit dem Projekt Report kuratierten?
Am schwierigsten war es 1999 für mich, dass ich die Biennale von Venedig noch nie live gesehen hatte. Kuratorin wurde ich im Zuge eines Wettbewerbs, dem ersten dieser Art. Damals war das Reisen schwieriger und als Museograph verdiente man nicht viel; man konnte es sich nicht leisten, Kulturausflüge zu machen oder verschiedene Ausstellungen zu besuchen. Das war nicht so üblich wie heute, wo es so viele Möglichkeiten gibt: Man kann die Documenta, Venedig etc. zu Studienzwecken besuchen. Damals schickten Institutionen ihre MitarbeiterInnen üblicherweise nicht ins Ausland, damit sie ihren Horizont erweitern oder eine internationale Perspektive bekommen können.
Ich gewann den Wettbewerb mit dem Konzept, mit dem ich mich bewarb. Aber während ich dieses Konzept entwickelte, sah ich nie, was wirklich in Venedig vor sich ging, ich hatte nur Zugang zu Katalogen. Ich wusste also über die vorherige Ausgabe Bescheid – über Adrian Guțăs Projekt am Rumänischen Kulturinstitut. Es war dies eine Rezension der rumänischen Kunst in den 1980er-Jahren und gleichzeitig ein Vorbote der Änderungen, die später stattfanden.
Auch das Zusammentreffen mit all den Pavillon-KuratorInnen im März und April war sehr hilfreich. Die Biennale begann im Mai, deshalb hatte ich die Möglichkeit, den rumänischen Pavillon zum ersten Mal einige Monate vor der feierlichen Eröffnung zu sehen, aber ich war allein dort. Finanziert wurde die Reise vom Kulturministerium; ich hätte die Künstler gerne mitgenommen, aber dazu reichten die Mittel nicht. Dan Perjovschi, Călin Dan und Iosif Király hatten Venedig höchstwahrscheinlich bereits als Kulturtouristen besucht, aber nicht, um eine ortsspezifische Ausstellung zu planen. Daria Ghiu erwähnt dies in ihrem Buch, in einem Kapitel über „abstraktes Kuratieren”. Und genau darum handelte es sich. Ich habe diese Erfahrung gemacht und das war für mich das Schwierigste daran. Was gut funktioniert hat, war, dass ich Zugriff auf Informationen (Bibliothek, Presseaussendungen) hatte, die mir eines verdeutlichten: Wer auf der Biennale ernstgenommen werden will, muss etwas sehr Aktuelles, sehr Zeitgemäßes vorweisen können. Und die betreffenden KünstlerInnen sollten in der internationalen Kunstwelt einigermaßen bekannt sein.
Es ist also nicht ratsam, neue KünstlerInnen mitzubringen, die nicht international bekannt sind, selbst wenn sie gut sind. Sie müssten wirklich hervorragend sein, um die mangelnde Medienpräsenz wettzumachen. Am besten nimmt man mit aufstrebenden KünstlerInnen teil, die sich gerade einen Ruf machen. Viele KünstlerInnen werden erst später international bekannt, wie etwa Geta Brătescu. Ich hatte also meine Wahl getroffen: Da waren die Gruppe subREAL und Dan Perjovschi, die damals schon über die Grenzen hinaus bekannt waren.
“Ich hatte Namen ausgewählt, keine Konzepte.”
Ich hatte Namen ausgewählt, keine Konzepte. Ich überlegte, was sie verbinden könnte, unterhielt mich mit ihnen und fand einen gemeinsamen Nenner: subREAL hatte ein Archivierungsprojekt und beschäftigte sich mit Dokumenten des Kunstmagazins Revista ARTA und dem gesamten dazugehörigen Programm; Dan Perjovschi archivierte die Gegenwart, seine Zeichnungen waren tägliche gesellschaftliche Kommentare und erinnerten an die Arbeit eines Reporters.
Daraus entstand die Idee für Report; es ergab vom Konzept her Sinn und schuf auch eine Verbindung zwischen den Künstlern. Dann stellte sich heraus, dass es eine Widersprüchlichkeit zwischen dem, wie Perjovschi das Konzept wahrnahm, und der Vision von subREAL gab. Dan Perjovschis Rezeption hatte eine größere Wirkung, er zeichnete schlussendlich auf Englisch auf den Boden des Pavillons. Einige der Skizzen waren mit Notizen versehen, die den Betrachter/die Betrachterin direkt zu einer bestimmten Reaktion aufforderten, während die Arbeit der Gruppe subREAL rätselhafter war; dazu gehörte die Fotoserie Serving Art, die – abgesehen von ihrer visuellen Wirkung – nur zu verstehen war, wenn man den Katalog oder zumindest eine Presseerklärung las. Das ist ein Widerspruch. Ich meine das nicht negativ, aber es fiel in der lokalen Rezeption der Werke auf. Die Medienberichte über den rumänischen Pavillon waren damals hingegen positiv; das Thema wurde nicht zur Sprache gebracht.
<!-- [if gte mso 9]>
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
21
false
false
false
DE-AT
X-NONE
X-NONE
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
t{mso-style-name:"Normale Tabelle";
tmso-tstyle-rowband-size:0;
tmso-tstyle-colband-size:0;
tmso-style-noshow:yes;
tmso-style-priority:99;
tmso-style-parent:"";
tmso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
tmso-para-margin-top:0cm;
tmso-para-margin-right:0cm;
tmso-para-margin-bottom:10.0pt;
tmso-para-margin-left:0cm;
tline-height:115%;
tmso-pagination:widow-orphan;
tfont-size:11.0pt;
tfont-family:"Calibri","sans-serif";
tmso-ascii-font-family:Calibri;
tmso-ascii-theme-font:minor-latin;
tmso-hansi-font-family:Calibri;
tmso-hansi-theme-font:minor-latin;
tmso-fareast-language:EN-US;}
<![endif]-->
Wie kam es zu When History Comes Knocking mit Plan B in Berlin? Warum haben Sie diese KünstlerInnen für diesen Kontext ausgewählt?
In dieser Ausstellung ging es um rumänische Kunst und ihre Phänomene rund um 1989, die Kunst der 1980er- und 1990er-Jahre, wobei der Schwerpunkt auf KünstlerInnen mit einem experimentellen Ansatz lag. Das Thema, das ich untersuchen wollte, war der postkommunistische Übergangsprozess, ausgehend von der Überlegung, dass die Transformationen, die 1989 stattfanden, schon vor der Revolution begannen und Veränderungen in Verhaltensmustern, Mentalität und Kultur mit sich brachten.
Natürlich dauerte der Demokratisierungs- und Kapitalisierungsprozess der rumänischen Gesellschaft etwa zehn Jahre, was uns dazu veranlasste, KünstlerInnen aus den 1980er- und 1990er-Jahren auszuwählen, die mit Fotografie, Video, Installation, Aktion, Performance oder sogar digitaler Kunst arbeiteten. Diese experimentelle Richtung war vor 1989 weitaus weniger sichtbar, weil sprachliche und technologische Neuerungen vom System nicht toleriert wurden.
Die Revolution bedeutete eine „Eruption“ dieser künstlerischen Medien in der rumänischen Kunst, weil die neu gewonnene Freiheit auch als eine Art Öffnung hin zu neuen Genres und künstlerischen Mitteln gesehen wurde. Die KünstlerInnen wollten experimentieren, sie wollten sehen, was mit einem Camcorder oder einer Digitalkamera möglich ist.
In den frühen 1990er-Jahren gab es also eine Dringlichkeit in der Kunstszene; die KünstlerInnen versuchten, all das nachzuholen, was vor der Revolution nicht möglich war, den neuen Anforderungen gerecht zu werden, neue Orte zu finden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab jede Menge Impulse und jeder versuchte, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Man sah die neuen Medien als das geeignetere Mittel, um schnell wieder Anschluss an die zeitgenössische internationale Kunstszene zu finden.
Wir wählten jene KünstlerInnen aus, die mit entsprechenden Werken in der Vergangenheit diese Richtung eingeschlagen hatten. Ich habe versucht, den Eindruck einer historischen Ausstellung zu vermeiden, auch wenn die Geschichte im Titel vorkommt. Ich wollte keine Museumsausstellung konzipieren.
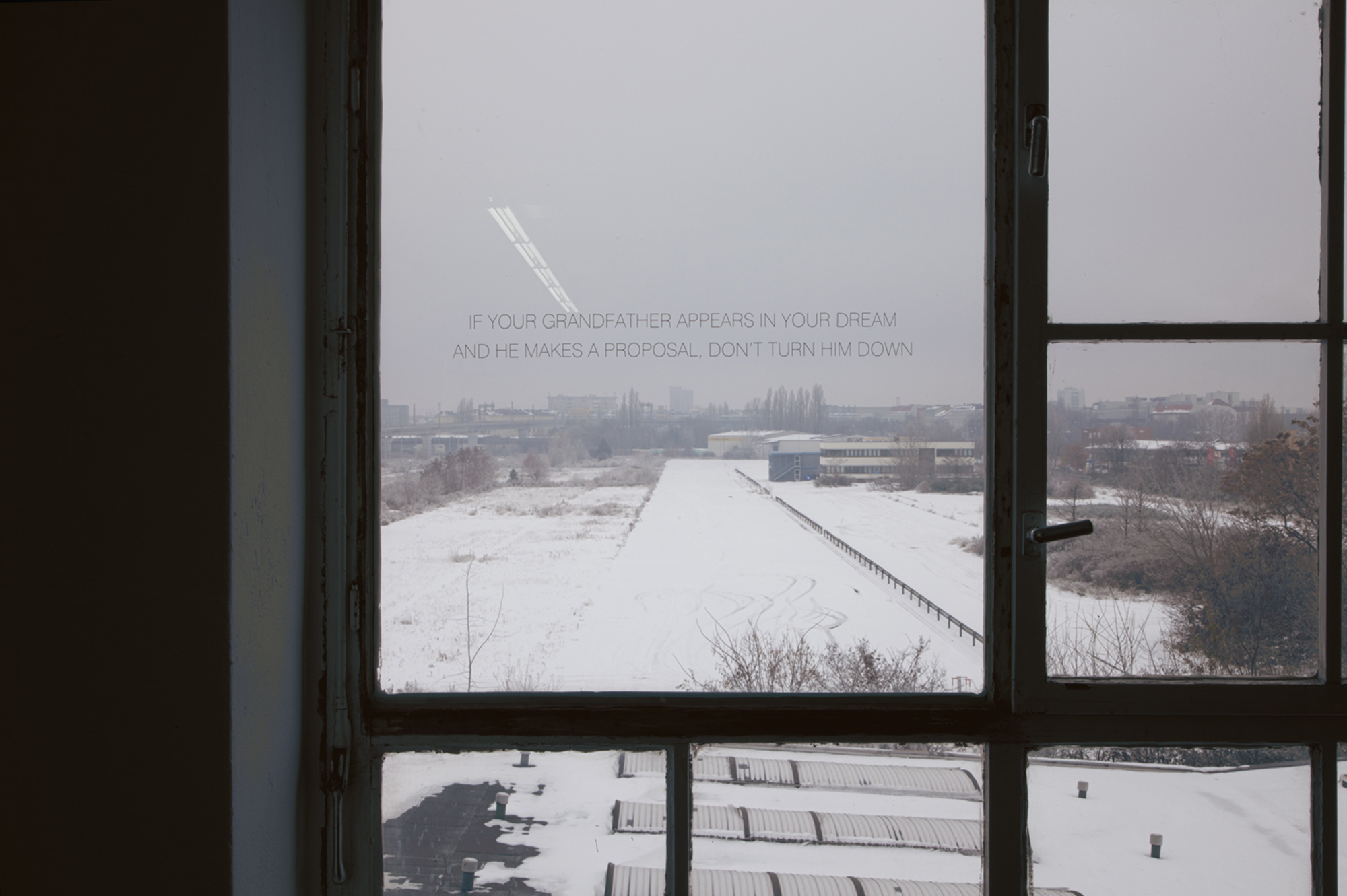
When history comes knocking: Rumänische Kunst aus den 80ern und 90ern hautnah, Sándor Bartha, Galerie Plan B Berlin, mit freundlicher Genehmigung von Galerie Plan B
Entstand When History Comes Knocking auf Einladung von Mihai Pop?
Ja, ich wurde von Mihai Pop eingeladen, dieses Projekt zu machen. Er wollte eine Ausstellung über kulturelle und gesellschaftliche Transformationen in der rumänischen Szene der späten 1980er und frühen 1990er. Früher oder später werden diese Jahre auch historisiert werden. Aber Mihai Pop wollte die Dinge beschleunigen und schlug vor, dass wir das jetzt tun. Das Thema, das er anregte, war zufällig auch Gegenstand meiner Dissertation.
Es war eine sehr gute Zusammenarbeit, inspiriert von den damaligen Räumlichkeiten der Galerie Plan B in Berlin – es war ihr erster Standort in Berlin, nicht der, wo die Galerie heute untergebracht ist. Da die Ausstellung experimentelle Richtungen anvisierte, wollten wir nicht nur den sogenannten Ausstellungsraum verwenden, sondern auch die angrenzenden Räumlichkeiten. Wir präsentierten Werke in der Lobby, im Büro und im Depot. Wir öffneten mit diesem außergewöhnlichen Ansatz tatsächlich alle Plan-B-Räume.
Erzählen Sie mir von der Zeit, als Sie für die Műcsarnok/Kunsthalle in Budapest arbeiteten und einige der bedeutenderen Projekte, die sie dort realisiert haben.
Im Kunstmuseum in Arad hatte ich über meinen eigenen Zeitplan verfügt. Ich fand es also sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen, eine angestellte Kuratorin zu sein, was bedeutete, dass ich in den meisten Fällen nicht an meinen eigenen Projekten arbeitete. Nach zwei oder drei Jahren konnte ich allerdings die Projekte machen, die ich auch machen wollte. Die erste Ausstellung hieß Szervíz und fand 2001 statt. Wir analysierten Möglichkeiten, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, basierend auf den Regeln des Spiels, zu dem wir die KünstlerInnen aufforderten. Ich entwickelte eine Regel für das Angebot von Dienstleistungen, die von einem Marketing-Leitfaden inspiriert ist (was bedeutet es, ein Service anzubieten und wie verhält man sich dabei), und rief KünstlerInnen dazu auf, ihre Projekte auf der Basis dieser Prinzipien einzureichen. Die Bedingung war, dass die angebotene Leistung real sein musste, dass also der Besucher/die Besucherin etwas Greifbares angeboten bekäme, das eine Begegnung mit dem Künstler/der Künstlerin ermöglichte.
Dies war eine Reaktion auf die ungarische Kunstszene, die gerne in Selbstmitleid versank. Die KünstlerInnen lebten wie in einem Elfenbeinturm und beklagten sich über den fehlenden Kontakt zum Publikum. Ich dachte mir, wenn das Problem in der Kommunikation liegt, dann lasst uns doch eine Situation schaffen, in der Kommunikation nahezu unumgänglich ist. Daraus entstand die Idee, Dienstleistungen anzubieten, die eine Begegnung zwischen KünstlerInnen und Öffentlichkeit erleichtern und einen persönlichen Kontakt ermöglichen. Zu meiner Überraschung fand diese Ausschreibung großen Anklang. Wir erhielten insgesamt 35-40 Vorschläge, aus denen ich eine Auswahl traf und die Kunstschau zusammenstellte.
Wie es der Zufall wollte, fanden gleichzeitig mit Szervíz zwei andere Ausstellungen in der Kunsthalle statt. Diese Konstellation war sehr interessant, weil der Kurator einer der parallelen Ausstellungen – Zsolt Petrányi, der später Direktor der Kunsthalle wurde – ein Projekt hatte, das sich mit dem Klima der ungarischen Kunstszene beschäftigte. Die Werke wurden standardgemäß an den Wänden präsentiert: Malereien, Videos, Fotos. Unsere Dienstleistungen waren Projekte in der Mitte der Räume. Die beiden Ausstellungen, die sich die Räumlichkeiten teilten, ergänzten einander also. Es war aufregend und irritierend zugleich – manche waren irritiert, andere inspiriert, weil sie (die andere Ausstellung) unseren Hintergrund bildete.
Die für das Projekt bereitgestellten Mittel – keine schlechte Summe, viel Geld für die damalige Zeit – wurden für die Produktion verwendet. Wir konnten es uns aber nicht leisten, ein Schaufenster für unsere Serviceleistungen zu gestalten, selbst wenn wir es gewollt hätten. Es wäre zu plakativ gewesen. Deshalb war es ein glücklicher Zufall, dass wir eine „klassische” Ausstellung rund um uns hatten. Wir stellten uns also den BesucherInnen mitten im Raum in den Weg und verkörperten den performativen Aspekt.

Servíz – V. Ferjencsik, M. Erhardt, T. Varnagy – How is the picture put together. Nowadays 2, Kunsthalle Budapest
Der Aufbau von Szervíz war so performativ wie die Projekte der KünstlerInnen. Und diese waren sehr spannend, zum Beispiel Peter Heckers Rent an artist. In Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen erstellte er ein Portfolio und während der Schau konnten BesucherInnen gegen eine bestimmte Gebühr einen Künstler/eine Künstlerin aus seinem Projekt mieten. Manche von ihnen wurden tatsächlich gemietet. Die Dienstleistung bestand aus einem Abendessen mit der Person, die den Künstler/die Künstlerin gemietet hatte und einer Diskussion über Kunst. Oder der Künstler/die Künstlerin schlüpfte in die Rolle eines Ausstellungsführers für zeitgenössische Kunst. Es gab ein paar betuchte Kunstliebhaber, die zahlten. Sie mieteten eine/n Künstler/in und gingen gemeinsam zu einer Ausstellungseröffnung, wo der Künstler/die Künstlerin erklärte, worum es ging.
Szervíz hatte noch ein anderes sehr gutes Projekt – es stammte von Sándor Bartha. Es gab damals bereits Mobiltelefone, aber sie waren noch nicht so verbreitet wie heute. Er entwarf in der Ausstellungshalle einen geschützten Raum mit einem Polstersessel und einem Festnetztelefon, von dem aus man die drei KuratorInnen der parallelen Ausstellungen anrufen konnte. Über das Callcenter wurde man mit dem Handy der KuratorInnen verbunden; man konnte sie also anrufen und über die Ausstellung oder irgendwelche andere Dinge sprechen. Ich hoffte sehr, dass es klappen würde, aber die beiden anderen Kuratoren waren skeptisch. Letzten Endes störte es sie, dass die BesucherInnen, die mit ihnen reden wollten, sie an den Wochenenden, während ihrer Freizeit oder am Sonntagstisch anriefen.
Für die Dauer der Ausstellung führten wir viele Gespräche mit verschiedenen BesucherInnen. Manche riefen einfach an, um zu testen, ob das Service auch wirklich funktionierte. Andere stellten Fragen, waren unzufrieden mit bestimmten Aspekten der Ausstellung. Da musste ich dann ein paar Lektionen in Kunstgeschichte erteilen, um zu erklären, wie Kunst nach Duchamp funktioniert. Im Allgemeinen waren es nette Gespräche. Ich denke, dass diejenigen, denen die Ausstellung nicht gefiel, einfach nicht anriefen. Es gab auch einige unzufriedene BesucherInnen. Ich erinnere mich an eine Journalistin, die eine negative Kritik in einer damaligen konservativeren Zeitung verfasste. Von der Museumsaufsicht erfuhr ich, dass sie nicht länger als zehn Minuten in der Galerie gewesen war. Es wunderte mich, dass sie das Telefonservice nicht benutzt hatte, wenn es irgendeinen Klärungsbedarf gab. Es war eine sehr herausfordernde Erfahrung, mit den BesucherInnen in diesem anonymen Kontext am Telefon zu sprechen. Wir sahen uns ja nicht und waren dadurch vielleicht offener zueinander. Die Menschen öffneten sich und sagten uns ehrlich ihre Meinung. Die Anonymität funktionierte gut, die Leute waren echt mutig.
Es gab noch eine Schau mit der lokalen Kunstszene von Cluj, European Travellers, die irgendwo zwischen einem kuratorischen Programm und meiner Arbeit als beauftragte Kuratorin angesiedelt war. Die zwei Direktoren der Kunsthalle – der scheidende und sein designierter Nachfolger – wollten beide eine Schau über die Kunst aus Cluj machen, weil sie von der Kunsthochschule Cluj und der Pinselfabrik gehört hatten. Es war cool, Kunst aus Cluj zu haben und da ich Rumänin bin, dachten sie, ich wäre die geeignetste Person, das in die Hand zu nehmen. Offen gestanden, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nie daran gedacht, eine Ausstellung über Kunst zu machen, die aus einer Stadt kommt.
Genau das wollte ich Sie fragen: Was verbindet diese KünstlerInnen Ihrer Meinung nach?
Ich wählte eine andere Herangehensweise, ich habe versucht, eine konstruktive Haltung gegenüber allem, was ich tun sollte, einzunehmen und dachte: Ich werde nicht Kunst aus Cluj ausstellen, ich werde stattdessen die Kunstszene aus Cluj präsentieren, was etwas ganz anderes ist, wenn Sie mich fragen. Freilich präsentierten wir mit der Ausstellung Malereien, Skulpturen, Videos und Fotografien, aber dahinter standen die unterstützenden Kunstinstitutionen.
Im Ausstellungskatalog tritt dieser Aspekt am deutlichsten zum Vorschein: Es gibt eine Liste der KünstlerInnen und der Institutionen, die diese unterstützen. Ich war schon immer an der Dynamik der Kunstszenen interessiert, gerade weil ich als Kuratorin von Beginn an mit Institutionskritik zu tun hatte: Mich interessiert die Verbindung zwischen Kunst und Soziologie. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, Kunstsoziologie zu studieren, aber mich faszinierten soziologische Analysen und die Betrachtung des Kunstkontexts aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Mich interessierte also schon immer die Dynamik einer Kunstszene. Ich schreibe seit den späten 1990er-Jahren über das rumänische Umfeld.
Vor diesem Hintergrund erschien es mir sinnvoll, diese Ausstellung nur dann zu organisieren, wenn ich mit der Kunstszene von Cluj arbeiten konnte. Diese Strategie wurde akzeptiert. Als ich das Konzept ausarbeitete, präsentierte ich nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern zeigte auch, was dahinterstand, also die Einzel- und Gruppeninitiativen – besonders im Privatsektor, da es, abgesehen vom Kunstmuseum Cluj, der Universität für Kunst und Design in Cluj und der Pinselfabrik (eine Gemeinschaftsinitiative, die aber trotzdem privat ist) keine anderen Institutionen gab. Ab den späten 1990er-Jahren zog sich die Soros-Stiftung aus Rumänien zurück und hinterließ ein institutionelles und finanzielles Vakuum; 1999 wurde unter anderem die AltArt Association gegründet, gemeinsam mit Balkon, aus dem schließlich Idea wurde. Die Menschen fanden neue Wege, aktiv zu werden und dabei eigenständig zu bleiben.
EAST ART MAGS lesen im erstestiftung.org Magazin
EAST ART MAGS (EAM) ist ein Gemeinschaftsprojekt von vier Kunstzeitschriften in Ostmitteleuropa: Artalk (Tschechien/Slowakei), Artportal (Ungarn), Revista Arta Online (Rumänien) und SZUM (Polen). EAM versteht sich als Plattform zur Aufbereitung und Veröffentlichung von Inhalten verbunden mit dem Angebot von Capacity Building für KunstjournalistInnen in der Region. EAM wird unterstützt vom VISEGRAD FUND und AFCN.
erstestiftung.org teilt ausgewählte EAM Artikel, übersetzt sie ins Deutsche und – falls noch nicht verfügbar – ins Englische.
Es war eine schöne Erfahrung, zum ersten Mal mit einem Architekten, Attila Kim, zusammenzuarbeiten. Mir gelang es, Gábor Gulyás, den damaligen Direktor der Kunsthalle, zu überzeugen, dass wir einen Architekten gebrauchen konnten, der ebenfalls – nicht nur bildlich – am Konzept arbeiten und uns helfen würde, die gesamte Ausstellung zu arrangieren und aufzubauen.
Seine Idee war es, die Institutionen in der Apsis sitzen zu lassen; da der Plan der Kunsthalle für den Ausstellungsraum dem Grundriss einer Kirche entspricht, gibt es im hinteren Bereich eine Apsis als wichtigsten Teil, als Motor. Die Stärke der Kunstschau lag darin, dass die Kunstwerke im Vordergrund standen, während die Institutionen in den Hintergrund gerückt wurden – eine symbolische Positionierung.
Attila konstruierte eine Art Werktisch für alle, einen Leuchtkasten mit einer Lampe, die eine Hell-Dunkel-Atmosphäre erzeugte, ein Halbdunkel. Es wirkte wie ein work in progress, als ob die Menschen Tag und Nacht bei der Arbeit säßen. Selbstorganisierte Initiativen und Institutionen wie die Kunsthochschule wurden eingeladen, sich in dieser Ausstellung zu präsentieren. Natürlich wurden die Künstler ausgewählt; ich sprach mit jedem einzelnen und entschied dann, was die praktikabelste und vernünftigste Möglichkeit war, sie auszustellen.
Sie sind seit Ende 2013 amtierende Direktorin von tranzit.sk / Bratislava. Was sind für Sie die bedeutendsten Projekte bei tranzit.sk? Erzählen Sie mir ein wenig über das letzte Projekt, Small/Big World.
Es war eine Herausforderung, in einem Kontext zu arbeiten, der mir zumindest anfangs fremd erschien, und mit einer Sprache wie Slowakisch, die ich nicht verstand. Natürlich spricht jeder Englisch, aber darum geht es nicht. Es geht um das Sozialleben in seiner Komplexität, es geht um Artikel über Kunstgeschichte: Sehr viel Material ist nur auf Slowakisch verfügbar. Wir sprechen hier über eine andere Geschichte, einen anderen Kontext, den ich nicht verfolgen konnte, seit ich Kuratorin bin. Während meiner Tätigkeit in Arad war es für mich selbstverständlich zu verfolgen, was in Ungarn passierte; über die Vorgänge in der Slowakei wusste ich jedoch nicht Bescheid, ich hatte keinen Bezug und keine Kontakte. Daher waren der Kontext und die Sprache selbst eine Herausforderung und sind es immer noch.
Andererseits lud man mich ein, mich für diesen Job zu bewerben und ich gewann den Wettbewerb. Ich musste ein Programm für einen neuen Kontext entwickeln, und ich wollte es nicht kühl erscheinen lassen, wie ein fremdes Produkt. Es durfte nicht unpassend sein. Ich wollte versuchen, meine persönlichen Ideen und Ansprüche an das Gegebene anzupassen, den Anforderungen gerecht zu werden und einige der Lücken in der Kunstszene so gut wie möglich zu schließen: Es ging darum, ein Programm zu entwerfen, zu versuchen etwas zu tun, das andere nicht tun.
Es war schwierig, die slowakische Kunstszene recherchieren zu müssen und nebenbei ein relevantes und kohärentes Ausstellungsprogramm auszuarbeiten. Ich versuchte zu reagieren – mit interessanteren und aufregenderen Ausstellungs- und künstlerischen Modellen, die hier nicht so bekannt sind. In der Slowakei hat die Konzeptkunst zum Beispiel Tradition, besonders in den 1970er-Jahren: Konzeptkunst und Objektkunst, die sich nicht zwangsläufig überschneiden. Ich wollte also einige forschungsbasierte Kunstprojekte vorschlagen. Kunst, die ein Projekt umfasst, ist weitaus weniger verbreitet.
“Daher waren der Kontext und die Sprache selbst eine Herausforderung und sind es immer noch.”
Mein Interesse konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft, ein Thema, mit dem man sich in der Slowakei nicht besonders auseinandersetzt, obwohl ich sagen kann, dass es einige wenige KünstlerInnen gibt, die sich mit diesem Thema befassen. Es scheint auch, dass interdisziplinäre Kunst immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seit ich das Programm in Bratislava begonnen habe, habe ich all diese Aspekte in den Vordergrund gestellt, in dem Bestreben, mehr Vorträge und Workshops zu organisieren, einschließlich Kurse über Kunsttheorie und kuratorische Theorie.
Small Big World, das Projekt, das ich letztes Jahr organisierte, beruhte auf der Netzwerktheorie. Diese moderne Theorie besagt unter anderem, dass wenn du nicht Teil eines Netzwerks, eines Netzes bist, du wenig Überlebenschancen hast (davon ausgehend, dass jeder Teil eines Netzwerks ist, ist es heutzutage unmöglich, nicht zu einem zu gehören; und je entwickelter dein Netzwerk ist, desto höher sind deine Überlebenschancen – das ist die Struktur der derzeitigen Gesellschaft). Die Netzwerktheorie hilft uns auch, die Komplexität der heutigen Gesellschaft besser zu verstehen.
Ich befragte namhafte KünstlerInnen und KuratorInnen aus dem slowakischen Raum, genauer gesagt aus Bratislava, zu ihren Zielen und wollte wissen, was mit der Kunstszene hier nicht in Ordnung sei. Man erzählte mir, dass diese als ziemlich isoliert von der internationalen Kunstszene wahrgenommen wird, obwohl es auch hier positive Ausnahmen gibt.
Weiters wurde betont, dass die Szene sehr fragmentiert sei und dass gewisse Gruppen von Leuten nicht miteinander kommunizieren. Ich versuchte eine Erklärung dafür zu finden, und die Netzwerktheorie zeigte tatsächlich, dass daran nichts falsch ist: So ist eben die Struktur der menschlichen Gesellschaft, sie ist zersplittert in kleine Gruppen. Und ebendiese Gruppen sind mit bestimmten Knotenpunkten verbunden, die über Macht verfügen.
Newcomer wenden sich nicht dem Randpunkt zu, sondern dem Zentrum. Wer seine Werke zeigen will, würde dies lieber in der Kunsthalle als in einer kleinen Galerie tun, weil die Kunsthalle der magnetische Knotenpunkt ist. Gleichzeitig sind jene, die mit diesen Knoten verbunden sind, in kleine Gruppen aufgesplittert, die sich nicht notwendigerweise begegnen. Die Theorie wirft die Frage nach der Verbreitung von Informationen innerhalb dieser Gruppen auf. So kam ich auf den Titel Small Big World und die Idee, Projekte zusammenzutragen, in denen Freundschaft und Kommunikation mit Menschen aus anderen sozialen Schichten, mit anderen Hintergründen diskutiert werden.
Wir hatten Kunstwerke und wir skizzierten auch die Ergebnisse einer mit der Soziologin Zuzana Révészová ausgearbeiteten Online-Recherche. Ich sprach einige Fragen über Bratislavas Kunstszenen an und sie verfasste basierend auf den Antworten einen Essay, der von der Grafikerin, Katarína Balážiková, wie eine Infografik illustriert wurde. Das war Teil der Ausstellung; ich wollte die Rechercheergebnisse in einem anderen Format visualisieren, als sie in einem Buch zu veröffentlichen oder auf einer Webseite zu präsentieren.
“Newcomer wenden sich nicht dem Randpunkt zu, sondern dem Zentrum.”
Für mich bildete die Infografik eine Art Rahmen für die Ausstellung, und die Projekte waren Interventionen. Manche Werke waren auch in der Stadt zu sehen, in kleinen Ausstellungen, nicht nur in den Räumlichkeiten von tranzit. Martinka Bobriková und Oskar da Carmen bauten eine Kantine, die in einer Café-Bar eine Woche lang geöffnet war. Zu Mittag konnte jeder, der angab, zur Kunstszene zu gehören, dort essen und erhielt aufgrund seiner bzw. ihrer sozialen Stellung kostenlos eine warme Mahlzeit. Wir hatten dadurch die Möglichkeit, den sozialen Status von KünstlerInnen, der – wie wir alle wissen – normalerweise ziemlich prekär ist, zu analysieren und aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Damit hatte das Projekt auch eine kritische Dimension.
An welchen Projekten würden Sie gerne arbeiten, zu denen Sie bislang noch nicht gekommen sind?
Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren am Budapester Teil der Balkan Konsulat Ausstellung in Graz arbeitete. Ich war dort mit Lia Perjovschi. Sie stellte mir eine ähnliche Frage und ich sagte zu ihr, dass sich die Kunst, die mich interessiert, noch nicht gezeigt hat. Überraschenderweise reagierte Lia positiv. Sie antwortete, dass dies bedeute, dass ich weit in die Zukunft blicke und dass es gut sei, dass ich nicht in der Vergangenheit verweile. Heute stimmt meine Aussage nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ich hätte keine Kunst gesehen, die mich anspricht.
Was meine zukünftigen Projekte anbelangt, würde ich mir, wenn ich könnte, ehrlich gesagt selbst ein Stipendium anbieten und alles für mindestens ein halbes Jahr stehen und liegen lassen, um zu lesen, einfach zu lesen. Und dann sehen wir weiter. Ich würde gerne an Projekten arbeiten, die sich von den bisherigen unterscheiden. Ich möchte auf jeden Fall Forschungsprojekte machen, die über einen längeren Zeitraum laufen, zwei Jahre vielleicht, und ein bestimmtes Thema entwickeln. Aus den Ergebnissen der Forschung würde dann eine Autorenausstellung entstehen, ein künstlerisches Projekt, Workshops oder Filmvorführungen etc. Es sollte eine langfristige Studie sein, weil ich mich momentan als Direktorin einer Institution mit zeitsensitiven Projekten sehr zerrissen fühle, weil ich für eingeladene KuratorInnen und Mitwirkende verantwortlich bin.
Als Direktorin bin ich nicht nur Administratorin, ich muss auch einen intellektuellen Beitrag leisten, wenn ich über diese Projekte spreche, und ich muss mit den Themen ebenso vertraut sein wie ihre AutorInnen. Es schwirren viele Themen herum und in Zukunft würde ich diese gerne reduzieren. Die nächste Ausstellung, Start and Finish, befasst sich übrigens genau mit dieser Situation: Wir machen eine aktive Pause, in der wir versuchen, das Beste aus projektbasierter Arbeit und ihren Auswirkungen auf den Kulturproduzenten/die Kulturproduzentin und die Kunstinstitution herauszuholen. Die Bibliografie ist komplex, von Boltanski & Chiapello bis hin zu Boris Groys, Bojana Kunst; ich bin sehr gespannt.
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, am Ende eines Interviews diese Frage zu stellen: Wenn Sie Ihr gesamtes Schaffen in einem Wort zusammenfassen müssten, wie würde es lauten?
Intervention, Konstruktion, Haiku, nun ja, das sind drei Worte …
Dieses Interview entstand im Rahmen des Programms East Art Mags. Verfasst von Ada Muntean in Kooperation mit Revista Arta and Artalk.cz. Der Text wurde erstmals auf Revista Arta Online am 29. März 2018 veröffentlicht.
Original auf Rumänisch. Übersetzt auf Englisch von Marina Oprea. Aus dem Englischen von Barbara Maya.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt: © Ana Muntean. Bei Interesse an Wiederveröffentlichung bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Redaktion. Urheberrechtliche Angaben zu Bildern, Grafiken und Videos sind direkt bei den Abbildungen vermerkt. Infobox 1: Judit Angel. Foto: © Lilla Khoór. Infobox 2: Report, Dan Perjovschi, Subreal, Romanian Pavillion at Venice Art Biennale, 1999. Foto: © Iosif Király. Titelbild: European Travellers Art From Cluj Today, Kunsthalle Budapest. Foto: © Miklós Surányi.